Abraham Kuyper (Teil 3)
Abraham Kuyper: Der Wissenschaftler
Zurück in Holland, geht er weder in die Politik noch in den Pfarrdienst, sondern widmet sich zwei anderen immensen Herausforderungen: „Einerseits die Entwicklung des Calvinismus sowohl als Theologie wie als Lebensanschauung in einem System, das in den neuen Kontext des 19. Jahrhunderts paßt, und andererseits die Ausbildung junger Menschen, die dieses Programm theoretisch auszubauen und in die Praxis umzusetzen gewillt sind“ (C. Augustijn, „Abraham Kuyper“, S. 296). Er sah kaum Chancen, diese ambitionierten Pläne an bestehenden Universitäten umzusetzen, da er sich dort hätte mit dem akademischen Establishment arrangieren müssen. Er griff den bereits 1875 geäußerten Gedanken einer Universitätsgründung wieder auf und beabsichtigte die Bildung einer Lehrstätte auf Grundlage einer reformierten Weltanschauung. Kuyper wollte nicht nur das reformierte Bekenntnis gegenüber Liberalismus, Modernismus und Vermittlungstheologie behaupten, sondern offensiv den „christlichen Glauben für alle Fakultäten fruchtbar machen“ (Johannes Schick, Das Denken des Ganzen: Eine vergleichende Studie zu den Wirklichkeitsanschauungen Karl Heims und Herman Dooyeweerds angesichts der Herausforderungen durch Postmoderne und neue Metaphysik, Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht, S. 89). 1880 wurde die Freie Universität Amsterdam (holländ. „Vrije Universiteit Amsterdam“, abgekürzt VU) eröffnet. „Frei“ bedeutet in diesem Fall, dass die Hochschule „frei“ von Kirche und Staat arbeitet und ausschließlich von privaten Trägern finanziert wird. Die Hochschule verfolgte das erklärte Ziel, „die reformierten Studenten zur Übernahme verantwortlicher gesellschaftlicher Positionen vorzubereiten“ (D. van Keulen, „Der niederländische Neucalvinismus Abraham Kuypers“, S. 34). „Hier kommt das Ideal einer Wissenschaft zum Ausdruck, die ‚souverän im eigenen Bereich‘ bleibt und weder unter der Vormundschaft des Staates noch unter kirchlichem Kuratel sich ihrer eigenen Art entfremdet‘. Im Jahre 1880 hatte sie 5 Studenten, 1885 zählte sie 50 und 1900 126, davon studierten 76 Theologie. Sie hat ihrer Aufgabe jedoch erfüllt, zur Entwicklung einer einheitlichen Geistesart der reformierten Volksschicht beigetragen und die nötigen führenden Köpfe geliefert“ (C. Augustijn, „Abraham Kuyper“, S. 296).
Kuyper wird Professor an der VU und lehrt vor allem Dogmatik, Enzyklopädie der Theologie, niederländische Sprachwissenschaft, Linguistik und Ästhetik. In dieser Zeit schreibt er seine größten theologischen Bücher (Eine umfassende Bibliographie ist 2011 erschienen als: Kuipers, Tjitze, Abraham Kuyper: An Annotated Bibliography 1857–2010, Leiden : Brill ; Biggleswade: Extenza Turpin, 2011). Das einzige wissenschaftliche Werk im engeren Sinn bildet seine drei Bände umfassende Enzyklopädie der Theologie. Schon im Vorwort dieser Schrift macht er deutlich, dass er eine Wiederbelebung des reformierten Glaubens beabsichtigt. Kuyper will den kraftlos gewordenen Calvinismus, der teilweise sektiererische Züge mit starken Absonderungstendenzen aufwies, aus seiner Enge herausführen und für einen lebendigen Dialog mit der Gegenwartskultur zurüsten. Er beabsichtigt keine „Repristination des ursprünglichen Calvinismus. Vielmehr gelte es, diesen ‚in Berührung [zu] bringen mit dem menschlichen Bewusstsein, wie sich dieses am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt hat‘“ (D. van Keulen, „Der niederländische Neucalvinismus Abraham Kuypers“, S. 345–346). Zu seinen anderen bedeutenden Werken gehören seine Pneumatologie (3 Bde.), die Erklärungen zum Heidelberger Katechismus (4 Bde.), eine Ausarbeitung zur Allgemeinen Gnade (3 Bde.) sowie eine Veröffentlichung zur reformierten Liturgie. All diese Publikationen sind Sammlungen von Aufsätzen, die ursprünglich in der Wochenzeitschrift „Der Herold“ erschienen sind.
 Heute starte ich eine kleine Reihe über das Leben von Abraham Kuyper. Teil 1 der vierteiligen Reihe ist seiner Jugend und Ausbildung gewidmet.
Heute starte ich eine kleine Reihe über das Leben von Abraham Kuyper. Teil 1 der vierteiligen Reihe ist seiner Jugend und Ausbildung gewidmet.
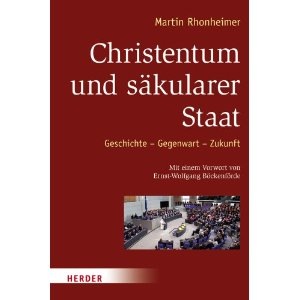 Ich lese gerade ein faszinierendes Buch des katholischen Philosophen Martin Rhonheimer mit dem Titel
Ich lese gerade ein faszinierendes Buch des katholischen Philosophen Martin Rhonheimer mit dem Titel