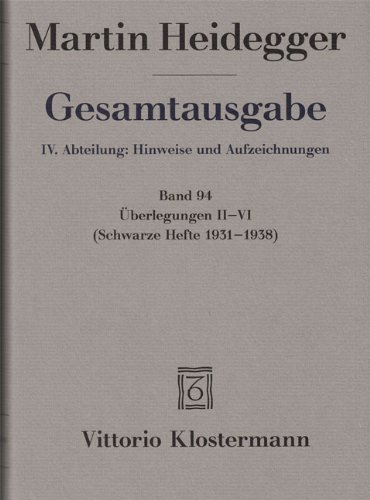Sigmund Freud und die Religion
Will man heute Freud angemessen gedenken, so braucht es ein gehöriges Maß “Entmythologisierung”. Besondere Beachtung verdiene laut Bonelli, Leiter der Forschungsgruppe Neuropsychiatrie an der Sigmund Freud Universität Wien, Freuds Verhältnis zur Religion sowie seine ausgeprägte Wissenschaftsgläubigkeit. Die Nachrichtenagentur KATHPRESS hat mit ihm gesprochen und meldet:
“Freud hat Religion schlichtweg abgelehnt, sie gar als Pathologie behandelt.” Religion sei für ihn immer “ein Reibebaum” gewesen: “Er hat sie abgelehnt, aber zugleich hat ihn Religion auch fasziniert”. Der Grund für diese Ablehnung sei “schlichtweg der Zeitgeist” gewesen: Es entsprach der Stimmung des ausgehenden 19. Jahrhunderts, dass Technik alles und Religion nichts war. “Darwin hat die Entstehung des Menschen erklärt, alles schien technisch machbar.” Gefangen im geschlossenen System Freud sei ganz dieser Weltanschauung verfallen gewesen, so Bonelli. Das werde nicht zuletzt bei Freuds Skizze der menschlichen Psyche als “psychischer Apparat” deutlich. “Bei Freud gibt es keinerlei Freiheit”, bringt Bonelli das Problem auf den Punkt: “Der Mensch ist eine Maschine, alles hat seinen Grund im Ich, Es oder Über-Ich”. Hinzu komme, dass Freuds Thesen – entgegen seinem eigenen Beharren auf strenger Wissenschaftlichkeit – bis heute “weder beweisbar noch falsifizierbar sind”, so Bonelli, sondern “ein eigenes, in sich geschlossenes System” darstellen. Dieses System habe Freud so sehr gegen Kritik immunisieren wollen, dass er sogar einzelne Fälle, die er selbst zur Stützung seiner Thesen heranzog, “gefaked” hat, so Bonelli. Damit jedoch sei klar, dass Freud nicht etwa nüchterner Beobachter gewesen sei, sondern “seine Weltanschauung, vor allem seinen Materialismus, tief hineingesenkt hat in seine Theoriebildung”. Als Person sei Freud ein schwieriger Charakter gewesen, so der Psychiater Bonelli weiter – “wie man es oft bei narzistischen Persönlichkeiten feststellen kann”: So verbat der aus jüdischer Familie stammende erklärte Atheist Freud etwa nach der Heirat mit seiner Frau Martha, einer gläubigen Jüdin, dieser jede Form der Religionsausübung. Seinen Kindern gegenüber sei Freud eher distanziert gewesen, wenngleich er sich für sie und ihre Entwicklung aus wissenschaftlich-psychologischer Sicht interessiert zeigte. Seinen Schülern und Mitarbeitern sei Freud “mal großväterlich, mal wie ein Tyrann” erschienen, der keine anderen Meinungen neben seinen eigenen duldete, so Bonelli.
Hier ein DLF-Gespräch über Freud mit Raphael Bonelli:
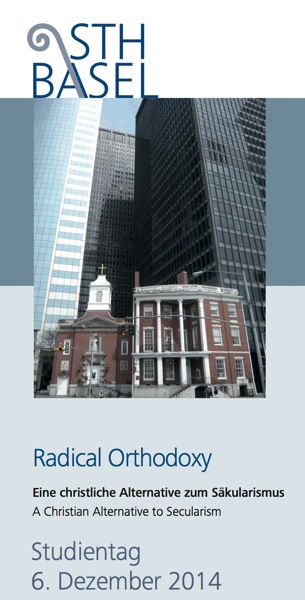 „Radical Orthodoxy“ nennt sich seit den 1990-er Jahren eine in England entstandene theologische Bewegung, die eine radikale und umfassende christliche Alternative zu der voranschreitenden Säkularisierung der westlichen Welt entwickelt. „Radical Orthodoxy“ kritisiert die kantische Metaphysik und wendet sich gegen eine Resignation des Christentums in Bezug auf die Wahrheitsfähigkeit von sprachlichen Ausdrücken. Die Ideen der „RO“ werden im englischen Sprachraum und darüber hinaus inzwischen intensiv diskutiert.
„Radical Orthodoxy“ nennt sich seit den 1990-er Jahren eine in England entstandene theologische Bewegung, die eine radikale und umfassende christliche Alternative zu der voranschreitenden Säkularisierung der westlichen Welt entwickelt. „Radical Orthodoxy“ kritisiert die kantische Metaphysik und wendet sich gegen eine Resignation des Christentums in Bezug auf die Wahrheitsfähigkeit von sprachlichen Ausdrücken. Die Ideen der „RO“ werden im englischen Sprachraum und darüber hinaus inzwischen intensiv diskutiert.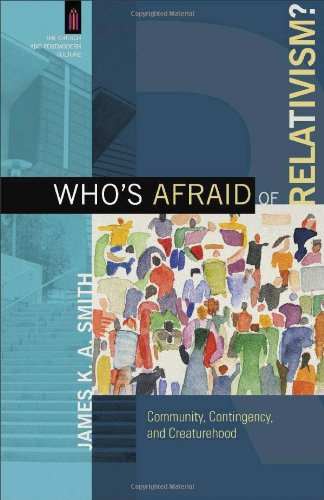 James K.A. Smith vom Calvin College in Grand Rapids (Michigan, USA) ist bekannt für seine Sympathien mit dem postmodernen Denken (siehe meine Kritik
James K.A. Smith vom Calvin College in Grand Rapids (Michigan, USA) ist bekannt für seine Sympathien mit dem postmodernen Denken (siehe meine Kritik