Hannah Bethke hat in ihrem Artikel „Entmündigung ist kein Seelentrost“ die sogenannte Basisbibel scharf kritisiert und dabei meines Erachtens ein wenig übertrieben (FAZ, 02.02.2021, Nr. 27, S. 9, vgl. auch den Beitrag: Die „Basisbibel“ ist da). Die Richtung ihrer Rezension stimmt aber. Es kann nicht sein, dass den Bibeltexten möglichst viele Anstöße genommen werden. Manche Anstöße muss man den Lesern zumuten, da nur auf diese Weist der Ursprungstext treu wiedergegeben wird und das Denken der Leser hinterfragt werden kann.
Bethke schreibt:
Es ist ja ehren wert, junge Generationen zum Lesen der Bibel und überhaupt von Büchern bringen zu wollen. Die Frage ist nur, ob das gelingen kann, wenn die Sprache so sehr verein facht wird, dass sie ihren Charakter verliert und mitunter sogar etwas ganz anderes aussagt. Warum sollte junge Leser das mehr reizen, als sich auf einen geheimnisvollen Text einzulassen, der viel leicht nicht immer gleich beim ersten Lesen verständlich ist, aber von einer anderen Zeit erzählt, und zwar gerade nicht durch den Filter heutiger Sprachgewohnheiten, sondern unvermittelt eigentümlich? Warum sollten junge oder neue Leser keine Freude daran haben, über einen Satz nach zu denken, der schwer zu verstehen ist, aber gerade durch die Tiefe der Reflexion zu neuen Erkenntnissen führt?
Als „Erstbegegnung“ mit dem Text, wie die EKD sie empfiehlt, eignet sich die Basisbibel gerade nicht. Man nimmt den Lesern des digitalen Medienzeitalters, die hier angesprochen werden sollen, die Möglichkeit einer tief wirken den, ungefilterten Lektüre, wenn man ihnen sofort die vereinfachte Variante vorsetzt. Man unter stellt ihnen nicht nur Bildungsferne, sondern auch Desinteresse am vertieften Lesen. Mehr noch: Man entmündigt sie, wenn sie schon, noch ehe sie es versucht haben, von allen Schwierigkeiten des Denkens befreit werden sollen.
Der Religionspädagoge Prof Dr. Bernd Beuscher hat dann in einem Leserbrief noch eine Schippe draufgelegt (FAZ, 05.02.2021, Nr. 30, S. 18). Obwohl ich seine Bedenken ebenfalls nicht völlig teile, liegt er meiner Auffassung nach richtig, wenn er darauf verweist, dass bei einer Übersetzung eben nicht alles der Zielkultur „unterworfen“ werden darf.
Beuscher sagt:
Jesus und Luther haben sich also nicht dem Zeitgeist und den sprachlichen Gepflogenheiten angepasst, sondern Tacheles geredet. Sprache ist ein bildgebendes Verfahren. Das Leben erzählt seine Geschichten. Bibelgeschichten sind Lebensgeschichten. Lebensgeschichten sind Glaubensgeschichten. Es geht beim „Dolmetschen“ der Bibel darum, das Hebräisch-Existentielle und Griechisch-Existentielle ins Deutsch-Existentielle oder in existentielles Deutsch zu übersetzen. Luther hat die Krisenfrage, was im Leben zählt, existentiell so klar und von allem Klerikalen entschlackt formuliert, dass er die Menschen ins Herz traf.
Die Basisbibel hat die theonome Dimension gelöscht. So ist aus einer „Theologie des Wortes“ eine „Theologie der richtigen Wörter“ geworden. Sie ist moralischer Kitsch, der das Märchen von der Selbstgerechtigkeit erzählt. Dann wird aus dem Nächsten der Mitmensch, aus Auferstehung die Auferweckung und aus Barmherzigkeit Mitleid. Wer mit der Basisbibel die Erstbegegnung mit dem Christentum hat, bekommt den Eindruck, Kirche sei Humanismus mit frommem Flair und konfessorischem Touch. Aus dem „fleischgewordenen Wort“ (Johannes 1) ist „wortgewordenes Fleisch“ geworden.
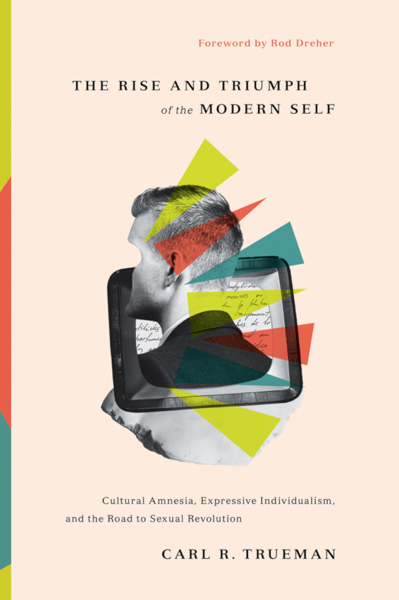 Daniel Vullriede hat das Buch The Rise and Triumph of the Modern Self (dt. Der Aufstieg und Triumph des modernen Selbst) von Carl Trueman gelesen und rezensiert.
Daniel Vullriede hat das Buch The Rise and Triumph of the Modern Self (dt. Der Aufstieg und Triumph des modernen Selbst) von Carl Trueman gelesen und rezensiert.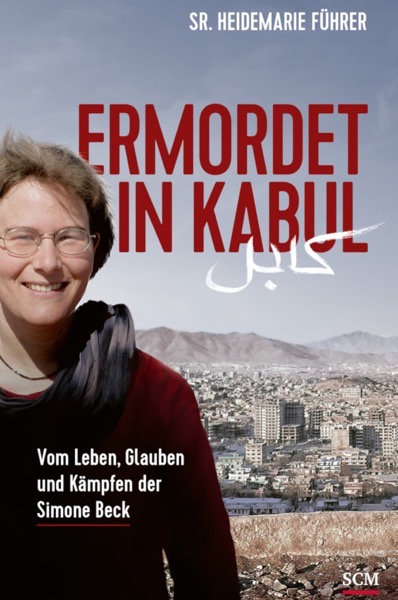
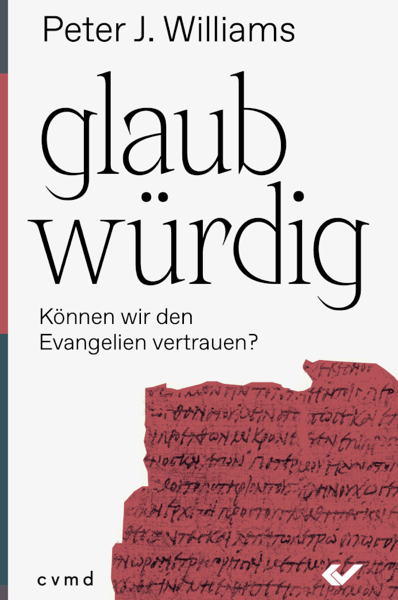 So manche Christen und solche, die sich für den christlichen Glauben interessieren, kämpfen mit der Frage, ob die Evangelien verlässlich über das Leben und den Dienst von Jesus Christus berichten. Peter J. Williams hat ein kleines, hilfreiches Buch über die Vertrauenswürdigkeit der Evangelien geschrieben. John Stoller stellt das Buch vor:
So manche Christen und solche, die sich für den christlichen Glauben interessieren, kämpfen mit der Frage, ob die Evangelien verlässlich über das Leben und den Dienst von Jesus Christus berichten. Peter J. Williams hat ein kleines, hilfreiches Buch über die Vertrauenswürdigkeit der Evangelien geschrieben. John Stoller stellt das Buch vor: In einer Besprechung des Buches:
In einer Besprechung des Buches: Das Thema „Singlesein“ ist im Gemeindealltag nicht gerade ein aktuelles. Dabei sind in den meisten Gemeinden recht viele Leute betroffen. Schön, dass Tim und Kathy Keller sich mit diesem Thema immer wieder beschäftigt haben. Meine Kollegin Lilia Stromberger hat Ihr Buch Solo, aber nicht allein für Evangelium21 besprochen. Fazit:
Das Thema „Singlesein“ ist im Gemeindealltag nicht gerade ein aktuelles. Dabei sind in den meisten Gemeinden recht viele Leute betroffen. Schön, dass Tim und Kathy Keller sich mit diesem Thema immer wieder beschäftigt haben. Meine Kollegin Lilia Stromberger hat Ihr Buch Solo, aber nicht allein für Evangelium21 besprochen. Fazit: