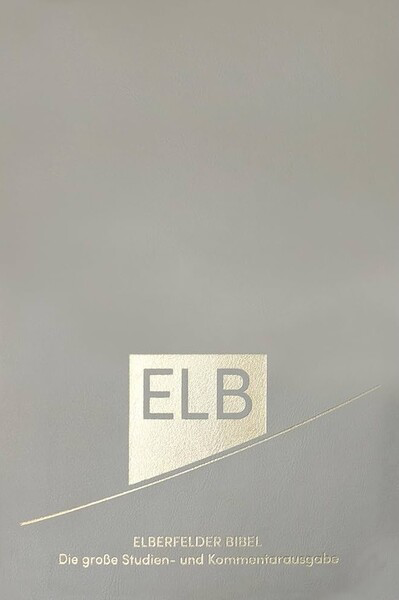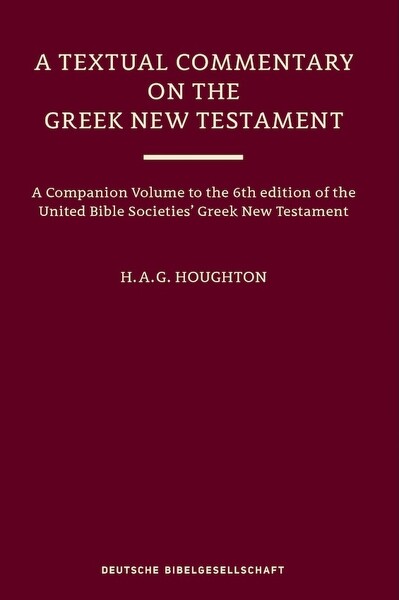“Nicht zu verachten …“ – Johannes Calvin und die Apokryphen
Wie bewertete Johannes Calvin die apokryphen Schriften des Alten Testaments? Matthias Freudenberg schreibt („‚Nicht zu verachten …‘ (Johannes Calvin) – Die Apokryphen im Spiegel der reformierten Theologie“, Catholica 76, 4 (2022), S. 234–47):
Wie in den bekannten Bibelausgaben der Reformation finden sich auch in der Bibel Pierre Robert Olivetans (1535) – einem Vetter Calvins – und in der Genfer Bibel (1546) die Apokryphen im Anschluss an die alttestamentlichen Bücher. Auch hier verdient Beachtung, dass sie überhaupt abgedruckt und nicht ignoriert wurden – jedenfalls in der Anfangszeit. In der Vorrede zu den Apokryphen in der Olivetanbibel (1535) schreibt Calvin, dass die Apokryphen gelesen werden, aber nicht öffentlich im Gottesdienst, sondern „im Geheimen und abseits“, also privat; sie seien „weder als verbindlich angenommen noch als legitim angesehen worden, weder von den Hebräern noch von der ganzen Kirche“.
Unter Bezug auf Hieronymus fährt er fort: „Wir haben sie abgetrennt und beiseite gesetzt, um sie besser zu unterscheiden und kenntlich zu machen, damit man weiß, aus welchen Büchern das Zeugnis als bindend angenommen werden muss und aus welchen nicht.“ Affirmativ heißt es, dass der Glaube Gewissheit im Wort Gottes erhält. Calvin liegt an der Glaubensgewissheit, und diese kann sich nur auf die Wahrheit der „lebendigejn] und kraftvollejn] Schrift“ gründen.
Ein Jahrzehnt später argumentiert Calvin in der Vorrede zu den Apokryphen der Genfer Bibel (1546), einer Revision der Olivetanbibel: „Diese Bücher, Apokryphen genannt, sind immer von den Schriften unterschieden worden, die man ohne Schwierigkeit als Heilige Schrift bezeichnete. Denn die Kirchenväter wollten der Gefahr vorbeugen, einige profane Bücher mit denen zu vermischen, die sicherlich vom Heiligen Geist hervorgebracht waren.“ Allerdings räumt er ein: „Es ist wahr, dass die Apokryphen nicht zu verachten sind, soweit sie gute und nützliche Lehre enthalten.“ Daraus erwachse „Lehre zur Erbauung“. Doch habe das, was durch den Heiligen Geist gegeben ist, Vorrang „vor allem, was von Menschen gekommen ist“. Glaubensgewissheit können diese Schriften nicht hervorrufen und seien daher nicht verbindlich, sondern sollen privat gelesen werden. Auch wenn Calvins Zurückhaltung gegenüber den Apokryphen unübersehbar ist, verzichtet er darauf, diese gänzlich abzuwerten. Ihm geht es um die Glaubensgewissheit, die der Heilige Geist mit Hilfe der kanonischen Schriften bekräftigt; von diesen müssen die Apokryphen als private Texte ohne Rechtskraft unterschieden werden. Calvin stellt die Glaubensgewissheit aus öffentlich beglaubigten Urkunden (Kanon) und die Lehre zur Erbauung (Apokryphen) aus Privatschriften einander gegenüber.
Ebenfalls 1546 erhielt Calvin Kenntnis von der Trienter Konzilsentscheidung, mit der in Sessio IV der Umfang des Kanons dogmatisiert und zum Alten Testament auch die Apokryphen gezählt wurden (DH 1502–1504). Ein Jahr später reagierte er darauf mit einer Streitschrift Acta Synodi Tridentinae cum Antidoto gegen die Konzilsakten und bestritt die Gleichrangigkeit der apokryphen mit den kanonischen Schriften sowie deren Einordnung ins Alte Testament; die apokryphen im Anschluss an die alttestamentlichen Texte einzuordnen, schloss er indes nicht aus.
Zudem machte er theologische Einwände. Es gäbe „keinen noch so ungeheuerlichen Aberglauben, zu dem sie nicht gleichsam den [siebenhäutigen] Schild des Ajax herantragen, um ihn damit beschützen zu wollen“; dazu zählen das Fegefeuer (2Makk 7,36; 12,43–45), die Vermittlung der Heiligen (2Makk 3,25–30; 10,29f.; 11,8), die Genugtuung (Tob 4,10f.; 12,9) und die Exorzismen (Tob 6,8.17). Einzelne Stellen aus den Apokryphen dienten zur Beglaubigung von kirchlichen Lehren, nämlich „zur Färbung ihrer Irrtümer mit unechter Schminke“: „Woher sollen sie besser den Bodensatz schöpfen [als aus den Apokryphen]?“ Allerdings räumt Calvin ein, dass er diese Bücher keineswegs gänzlich verdammen wolle. Doch eine Vertrauensbasis für den Glauben böten sie nicht. Im Übrigen widerspreche ihre Kanonisierung dem Konsens der Alten Kirche, da sie den Glauben nicht förderten.