Nachfolgend eine Rezension zum Buch:
- Ekkehard Graf: Durch Leiden geprägt: Die gegenwärtigen Leidenserfahrungen der indischen Nethanja-Kirche mit einem Blick auf die paulinischen Gemeinden, Dortmunder Beiträge zu Theologie und Religionspädagogik 10, Lit Verlag, 344 S., ISBN 364-3-643-11595-9, Euro 29,90.

Die Christen der noch jungen Nethanja-Kirche in Ostindien erdulden seit Jahren Bedrängnisse und Verfolgungen wegen ihres Glaubens. Trotz dieser Widerstände wächst die Kirche unablässig. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der erfahrenen Repression und dem Gemeindewachstum?
Ekkehard Graf, Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und Mitarbeiter beim „Arbeitskreis für Religionsfreiheit, Menschenrechte u. Verfolgte Christen“ der Evangelischen Allianz hat in seiner Promotion die Situation der indischen Kirche eingehend untersucht und sie mit der Verhältnissen der durch Paulus gegründeten urchristlichen Gemeinden verglichen.
Die von Professor Rainer Riesner betreute Arbeit enstand in den Jahren zwischen 2006 und 2011 und wurde 2012 von der Fakultät Humanwissenschaften und Theologie der TU Dortmund angenommen. Ekkehard Graf setzt drei Schwerpunkte. In einem ersten Teil wird die gegenwärtige Lage der indischen Nethanja-Kirche erfasst. Der Autor beleuchtet den gesellschaftlichen Hintergrund, auf dem die Kirche erwachsen ist, ihre Enstehung sowie Entwicklung und erfasst schließlich systematisch ihre Leidenserfahrungen. Da bisher nur spärlich über die Kirche publiziert wurde, musste die Lage der Christen aufwendig erschlossen werden. Graf konnte auf wenige schriflliche Quellen zurückgreifen, überwiegend auf das Mitteilungsblatt „Nethanja Post“ des deutschen Missionsvereins „Kinderheim Nethanka Narsapurt – Christliche Mission Indien“ e.V. und auf Liedgut, das 2007 erstmalig in einem Nethanja-Liederbuch gesammelt wurde. Das Buch enthält 489 Lieder, ungefähr 100 davon stammen von Pastoren und Musikern der Nethanja-Kirche. 12 dieser Lieder stehen in einem besonderen Zusammenhang mit aktuellen Leidenserfahrungen und wurden eingehend durchleuchtet. Darüber hinaus hat Graf Christen der Nethanja-Kirche aufwendig interviewt, Konversionsberichte ausgewertet und Gottesdienste beobachtet. Die narrativen Interviews sind im Anschluss an die Transkription statistisch verwertet und systematisch kategorisiert worden. Die Lektüre ist spannend und zugleich bedrückend. Geschildert werden unglaubliche Unterdrückungs- und Gewalterfahrungen, angefangen von sanfter Diskriminierung bis hin zu Familienausschlüssen, Massenvergewaltigungen und Mordanschlägen. Die dafür Verantwortlichen sind Familienangehörige, Hindus, Animisten, maoistische Naxaliten sowie staatliche Behörden.
Im zweiten Teil untersucht Graf die von dem Heidenapostel Paulus gegründeten Gemeinden. Die Leidenserfahrungen dieser Urgemeinden werden beschrieben und systematisch-theologisch betrachtet, um sie dann in ein Verhältnis zu den Erfahrungen der indischen Christen zu setzen. Graf zeigt einerseits, dass sich aufgrund der Lage der Nethanja-Kirche die paulinische Texte besser verstehen lassen (da vergleichbare Phänomene zugrunde liegen), sich andererseits auch zeigen lässt, wie „in Bedrängnis Glaube gelebt und Kirche gestaltet werden kann“ (S. 15). Es werden besondere Hilfe im Leiden herausgestellt. Dazu gehören die Hilfe durch die Gemeinde (S. 241–245), Hilfe durch das Gebet (S. 246–249), Hilfe durch Bibeltexte (S. 251–253), Hilfe durch die Christusbeziehung (S. 254–256) und sonstigen Beistand wie beispielsweise Wundererfahrungen (S. 258–260).
Die Bedrängnisse haben eminente Auswirkungen für das Leben der Christen. Graf untersucht diese zunächst im Bereich des Gemeindelebens (S. 263–278): „Die paulinische Aussage, dass Glaube, Liebe und Hoffnung Kennzeichen der bedrängten Gemeinde sind (lThess 1,3), lässt sich an der Nethanja-Kirche verifizieren, denn die Leidenserfahrungen prägen den von den indischen Christen praktizierten Glauben in hohem Maße. Die Bedrängnis führt zu stark frequentierten Gottesdiensten, in denen die Christen Gemeinschaft, Trost und Angenommensein erfahren. Im Gebet werden die Leiden vor Gott gebracht und [wird] gemeinsam für Erhörung gedankt. Die in der Nethanja-Kirche entstandenen Lieder helfen den Christen Gefühle und Überzeugungen in der ihnen eigenen Sprache und Melodik zum Ausdruck zu bringen. Im Singen von Lobliedern werden die Leiden in einem gewissen Maß relativiert und der Leidende wird zum Ertragen ermutigt. In Verkündigung und Lehre der Nethanja-Kirche spielen die Leiden Christi wie auch die Kreuzestheologie des Paulus eine große Rolle. Zudem sind alttestamentliche Personen von Bedeutung, die ein hohes Maß an Identifikation ermöglichen“ (S. 301). Die Leidenserfahrungen haben massive Konsequenzen für die Lebensführung der Christen (S. 281–292): „Das Leben in einer feindlich gesinnten Umwelt bringt die Christen zu einer Ethik, die orientiert an der christlichen Überlieferung, die richtige Balance von Abgrenzung und Zuwendung zur Gesellschaft sucht. Besonders in praktizierter Nächstenliebe tun sich die Christen der Nethanja-Kirche hervor und erfüllen damit die Weisung Jesu Christi. Für ihr Umfeld anstößig, aber motiviert vom Evangelium, überschreitet die Nethanja-Kirche bewusst die Grenzen der Kastenordnung, zudem wertet sie die Frauen in der Gemeinde auf. Trotz teils massiver Angriffe verzichten die Christen der Nethanja-Kirche konsequent auf Gewaltanwendung, selbst ehemalige Naxaliten in ihren Reihen entsagen einer Gegenwehr. Vielmehr beten sie für ihre Feinde und handeln an ihnen mit Taten der Barmherzigkeit. Gegenüber dem Staat verhält sich die Nethanja-Kirche in Distanz und Loyalität unterschiedlicher Nuancierung“ (S. 302). Schlussendlich schöpfen die Christen Hoffnung, indem sie inniglich die Wiederkunft ihres Herrn erwarten (S. 294–299): „Die Leidenserfahrungen prägen die Hoffnung der Christen, indem sie in Bedrängnis eine ermutigende Eschatologie entwickeln. Eine unmittelbare Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesus Christi zeigt sich in der Nethanja-Kirche ähnlich wie schon bei Paulus. Diese Parusie-Erwartung prägt die Christen und wird zur Ermutigung inmitten der Bedrängnis. Geduldig werden Anfeindungen ertragen in der Gewissheit, dass die Leiden dieser Zeit begrenzt sind im Gegensatz zu dem zu erwartenden Reichtum des Himmels. So prägt und motiviert das Ziel, mit Christus aufzuerstehen (Rom 6,3–5) und im „Buch des Lebens“ eingetragen zu sein (Phil 4,3), die Christen in den paulinischen Gemeinden wie auch in der Nethanja-Kirche: Die Tränen des Leides werden in der Ewigkeit abgewischt werden, aber auch schon in der Gegenwart in Freudentränen verwandelt angesichts der zu erwartenden Herrlichkeit. Diese Freude findet im gottesdienstlichen Gesang der Nethanja-Kirche ihren Niederschlag und richtet sich auf die Person Jesu, mit der der Glaubende im Leiden wie auch in der zu erwartenden Herrlichkeit persönlich verbunden ist“ (S. 302).
Die Untersuchung von Ekkehard Graf liefert eine erste zusammenhängende Dokumentation zur Kirchen- und Leidensgeschichte der Christen in Andhra Pradesch. Sie erweitert darüber hinaus allgemein das Verständnis für die Nöte und Segnungen einer bedrängten Kirche. Die Tragweite der Gemeinschaft, der Verkündigung, der Paraklese und der daraus resultierenden Ethik werden eindringlich zur Geltung gebracht. Die Geschichte der Nethanja-Kirche zeigt, dass in geradezu paradox anmutender Weise „in der Schwachheit des Leidens die Kraft der Verkündigung zunimmt“ (S. 305). Mögen die vom Autor am Schluss entwickelten Anregungen für die Christen der westlichen Kirchen Gehör finden.
– – –
PDF-Version der Rezension: EkkehardGraf.pdf.
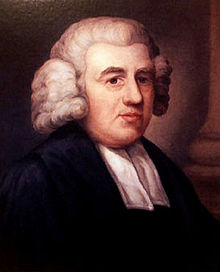 Der DLF hat einen kurzen Beitrag über John Newton und das Lied „Amazing Grace“ zusammengestellt. Wer war John Newton? Ich zitiere mal aus Wikipedia:
Der DLF hat einen kurzen Beitrag über John Newton und das Lied „Amazing Grace“ zusammengestellt. Wer war John Newton? Ich zitiere mal aus Wikipedia:
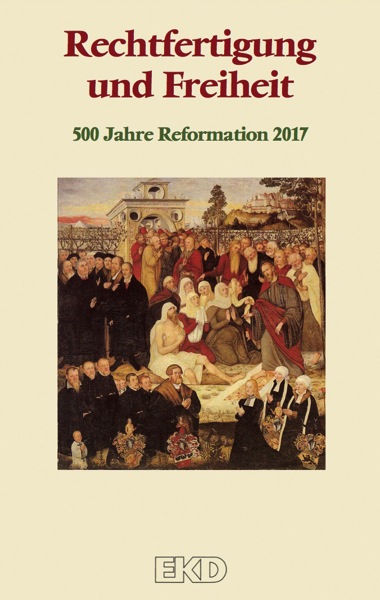 2017 jährt sich der Wittenberger Thesenanschlag Martin Luthers zum 500. Mal. Drei Jahre zuvor veröffentlicht die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) erstmals einen Grundlagentext zum Reformationsjubiläum.
2017 jährt sich der Wittenberger Thesenanschlag Martin Luthers zum 500. Mal. Drei Jahre zuvor veröffentlicht die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) erstmals einen Grundlagentext zum Reformationsjubiläum.