»Keine Begriffe des theologischen Wortschatzes rund um das Kreuz haben mehr Kritik hervorgerufen, als ›Genugtuung‹ und ›Stellvertretung‹«, schrieb John Stott 1986 in seinem vielleicht wichtigsten Buch: The Cross of Christ (S. 111).
Einerseits ist die Sühnetat von Jesus Christus alt- und neutestamentlich so vielfältig bezeugt, dass sie mit Recht zum Herz der christlichen Dogmatik gehört. Andererseits muss Josef Blank feststellen (»Weißt Du, was Versöhnung heißt« in Blank, Werbick (Hg.), Sühne und Versöhnung, 1986, S. 21):
Wahrscheinlich begegnet heute keine Lehre des Christentums größeren Schwierigkeiten als die traditionelle Lehre, daß uns Jesus Christus durch seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz von unseren Sünden erlöst hat.
Keine Frage, die Bibel überliefert uns eine Fülle von Begriffen, Bildern und Zugängen zum Versöhnungswerk von Jesus Christus. Wir finden nicht nur einen Typus der Versöhnungslehre (vgl. dazu G. Aulén, »Die drei Haupttypen des christlichen Versöhnungsgedankens«, Zeitschrift für Systematische Theologie, Jg. 8, 1930). Der klassische ›Christus-Victor‹-Typus betont beispielsweise in angemessener Weise die Siegestat von Christus über die Mächte des Bösen. Der lateinische Typus der Versöhnungslehre hebt demgegenüber den satisfaktorischen Gerechtigkeitsausgleich hervor, der Gott gegeben wird (und ist damit grundsätzlich (nicht argumentativ) älter als die ›Satisfaktionslehre‹ Anselms).
Aber doch fällt auf, dass die kirchengeschichtlich etablierten Typen der Versöhnungslehre seit der Aufklärung (vgl. besonders Kant und Schleiermacher) hinter eine humanisierende Versöhnungslehre zurückfallen. Heute wird bevorzugt nur noch von der Liebe Gottes gesprochen. Nicht Gott muss versöhnt werden, sondern Gott ist der versöhnende Versöhner für uns Menschen.
Was ist da passiert?
Der Gedanke, dass Christus stellvertretend für uns Menschen sterben musste, erscheint dem aufgeklärten Europäer als ungerecht und viel zu blutig. Die Vorstellung, dass ein Unschuldiger die Schuld der Welt auf sich nimmt und durch sein vollkommenes Opfer bezahlt, erinnert an einen kosmischen Kindesmissbrauch (vgl. z.B. Brock, Chalke o. McLaren). Rudolf Bultmann hat das Problem so formuliert (»Neues Testament und Mythologie« in: Kerygma und Mythos, 1954, S. 20) :
Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen (wenn man von einem solchen überhaupt reden darf) gesühnt werden? Welche primitiven Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrunde? Welch primitiver Gottesbegriff? Soll die Anschauung vom sündentilgenden Tode Christi aus der Opfervorstellung verstanden werden: welch primitive Mythologie, daß ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sühnt! Oder aus der Rechtsanschauung, so daß also in dem Rechtshandel zwischen Gott und Mensch durch den Tod Christi den Forderungen Gottes Genugtuung geleistet wäre: dann könnte die Sünde ja nur juristisch als äußerliche Gebotsübertretung verstanden sein, und die ethischen Maßstäbe wären ausgeschaltet!
Der aufgeklärte Mensch kann und will also mit seinem Selbstverständnis einen zornigen Gott überhaupt nicht mehr denken und bereinigt folglich die biblische Versöhnungslehre durch Verkürzung und Umdeutung von dem anstößigen Sühnewerk (vgl. z. B. die Zitate von Grün, Chalke u. Mann).
Aber ist Versöhnung mit Gott ohne Sühne möglich?
Nein! »Versöhnung bedeutet die Wiederherstellung eines guten Verhältnisses zwischen Feinden. Um dieses Verhältnis im Gegenüber von Gott und Mensch zu erreichen, müssen die Faktoren beseitigt werden, die die Feindschaft hervorrufen. Das geschieht durch Sühne« (H.-G. Link, »Versöhnung« in: Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, Bd. 2, S. 1309). Versöhnung mit Gott gibt es also nur als Versühnung durch Jesus Christus (vgl. a. 1Joh 2,2).
Ein Denkanstoß, da derzeit gern über Kontextualisierung gesprochen wird: Kann es sein, dass wir unter dem Einfluss des Humanismus die biblischen Sühnetexte in ihrer Schärfe und Härte gar nicht mehr wahrnehmen? Ist es der »aufgeklärte Verstehenshorizont«, der uns den Blick auf den zornigen Gott und die blutige Versöhnungstat am Kreuz vernebelt? Ist unsere Deutung des biblischen Befunds verzerrt durch moderne oder postmoderne Verstehensvoraussetzungen? Sollten wir deshalb nicht besser umgekehrt unsere Verstehens- und Lebenszusammenhänge auf der Grundlage der Heiligen Schrift deuten? Dann nämlich zeigt sich: Gott ist kein niedlicher jemand, der dafür da ist, unsere emotionale Bedürftigkeit zufrieden zu stellen. Gott ist gerecht und er ist heilig. Wir als Sünder können vor diesem Gott nicht bestehen und haben den göttlichen Zorn verdient. Es gibt nur eine einzige (Er)-Lösung (Röm 3,24–25):
Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie [die ungerechten Sünder] vor seinem Urteil als gerecht bestehen – aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott zum Sühneopfer verordnet. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt – und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen.
Wer verstanden hat, was »reine Gnade« ist, und damit weiß, dass sie nicht billig ist, und glaubt, muss mit staunendem und frohem Herzen Jesus Christus anbeten, der sich selbst für unsere Erlösung gegeben hat (1Tim 2,6)!
Empfehlungen zum Thema »Kreuz und Sühne«:
- John Stott, The Cross of Christ, Leicester: IVP, 1986.
- Martyn Lloyd-Jones, The Cross: God‘s Way of Salvation, Eastbourne, Kingsway, 1986.
- I. Howard Marshall hat eine hervorragende Untersuchung (mit vielen Quellen) zur Sühnetheologie verfasst, die frei herunter geladen werden kann: www.eauk.org.
Diesen Beitrag gibt es ebenfalls im PDF-Format: suehneundversoehnung.pdf
 Am 2. Februar 1950 erschien ein Artikel von Francis in der Zeitung The Christian Beacon, in dem er bereits thematisiert, was sich später durch die ganze Arbeit ziehen sollte: Heiligkeit und Liebe. Edith Schaeffer sagt dazu in ihrem Buch The Tapestry:
Am 2. Februar 1950 erschien ein Artikel von Francis in der Zeitung The Christian Beacon, in dem er bereits thematisiert, was sich später durch die ganze Arbeit ziehen sollte: Heiligkeit und Liebe. Edith Schaeffer sagt dazu in ihrem Buch The Tapestry: 1949 zogen die Schaeffers in das Bergdorf Champéry in der Schweiz. Dort geriet Schaeffer 1951 aus mindestens zwei Gründen in eine tiefe geistliche Lebenskrise. Erstens sah er im Leben derer, die für das historische Christentum kämpften, nicht die Kraft des Evangeliums. Die vielen Streitigkeiten zwischen den konservativen Christen, die er selbst mit durchlitten hatte, spielten dabei eine große Rolle. Zweitens erkannte er, dass die Erfahrung des Herrn in seinem eigenen Leben nicht so pulsierend war wie früher. Tatsächlich war er kein fröhlicher Christ, sondern wurde von belasteten Depressionen geplagt.
1949 zogen die Schaeffers in das Bergdorf Champéry in der Schweiz. Dort geriet Schaeffer 1951 aus mindestens zwei Gründen in eine tiefe geistliche Lebenskrise. Erstens sah er im Leben derer, die für das historische Christentum kämpften, nicht die Kraft des Evangeliums. Die vielen Streitigkeiten zwischen den konservativen Christen, die er selbst mit durchlitten hatte, spielten dabei eine große Rolle. Zweitens erkannte er, dass die Erfahrung des Herrn in seinem eigenen Leben nicht so pulsierend war wie früher. Tatsächlich war er kein fröhlicher Christ, sondern wurde von belasteten Depressionen geplagt.

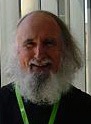 Der Benediktinerpater Anselm Grün, viel gelesener Autor spiritueller Bücher und beliebter Lebensberater schreibt in seinem Buch Erlösung (Kreuz Verlag, 2004, S .7) über das Sühneopfer von Jesus Christus:
Der Benediktinerpater Anselm Grün, viel gelesener Autor spiritueller Bücher und beliebter Lebensberater schreibt in seinem Buch Erlösung (Kreuz Verlag, 2004, S .7) über das Sühneopfer von Jesus Christus: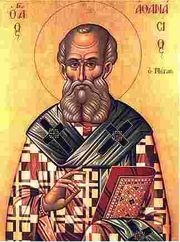 Athanasius von Alexandria (ca. 298–373 n.Chr.) war Bischof von Alexandria in Ägypten und wurde bereits zu Lebzeiten als Säule der Kirche und Vater der Orthodoxie bezeichnet. In seinem berühmten Brief über die Psalmen an Marcellinus schreibt er über den Tod von Jesus Christus:
Athanasius von Alexandria (ca. 298–373 n.Chr.) war Bischof von Alexandria in Ägypten und wurde bereits zu Lebzeiten als Säule der Kirche und Vater der Orthodoxie bezeichnet. In seinem berühmten Brief über die Psalmen an Marcellinus schreibt er über den Tod von Jesus Christus: