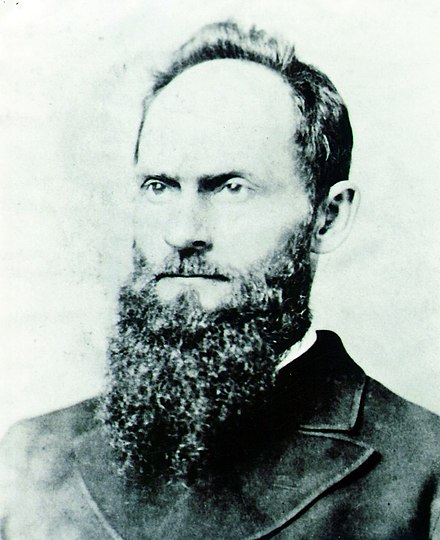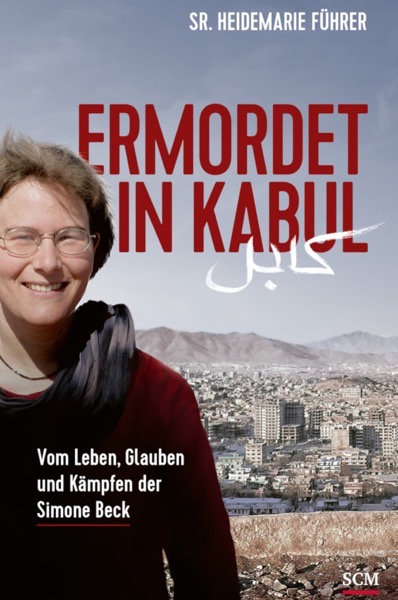Evangelisierung im Fußballstadion
Christliche Fußballer, die sich öffentlich zu ihrem Glauben bekennen, werden gerade von einer windigen oder sogar verlogenen Presse abgestraft. Die Tagesschau warf ihnen vor, Mission zu betreiben:
„Es wird als göttlicher Auftrag aufgefasst, Menschen zum ‚richtigen Glauben‘ zu bekehren, um so viele Seelen wie möglich zu erlösen“, sagt Freudenberg. Ansonsten drohten große Qualen für Sündiger. „Deswegen sehen Evangelikale es als Lebensaufgabe an, nicht nur die eigene Seele durch die Bekehrung zu retten, sondern auch andere für diesen Glauben zu gewinnen.
Ob den Verantwortlichen beim ÖRR aufgefallen ist, dass auch sie warnen und missionieren? Noch fragwürdiger ist ein Videobeitrag, den die ARD über die sozialen Medien verbtreitet. Ein dort kommunizierter Vorwurf: „Manche Fußballprofis leben ihr Glauben ganz offen“. Oh, wie schlimm! Die allseits geforderte Coming-out-Culture gilt also nicht für Christen, die ihre Identität „in Christus“ ernst nehmen? Oder wie soll ich das verstehen?
Da ist es ermutigend, dass DIE TAGESPOST sich der hochbezahlten Schwarmintelligenz entgegenstellt und Folgendes schreibt:
Es ist müßig, an dieser Stelle auf das profunde Missverständnis hinzuweisen, dass dem Bild von Religion als einzig und allein im stillen Kämmerlein zu betreibender Privatsache entspricht. Vielmehr darf man sich freuen, dass jungen erfolgreichen Fußballern das, wovon ihr Herz überfließt, wichtiger ist als die strategische Anpassung an die Erwartungen der Öffentlichkeit. Klar, Fußball war vor der Ära der Regenbogen-Armbinden auch deshalb mal so entspannend, weil es einfach einmal nicht um Politik ging – und agnostische Zuschauer mögen Glaubensbekenntnisse in gleicher Weise ärgern, wie den politisch dissidenten Zuschauer die plakative Zurschaustellung politischer Korrektheit. Hinzu kommt: vermutlich werden viele, die sich jetzt über Doué freuen, weniger Glücksgefühle erfahren haben, als sich der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger mit der auch bei Islamisten beliebten Geste des „Tauhid-Fingers“ zum Islam bekannte.
Und doch darf man als Christ ruhig so parteiisch sein, Doué, Felix Nmecha, Yemisi Ogunleye oder andere Sportler mit christlichem Bekennermut mit ungeteilter Freude und Dankbarkeit zu begegnen. Schließlich entspricht ihre Haltung schlicht dem Missionsbefehl Christi. Einige weitere Aspekte machen Mut: Offensichtlich schaffen im Spitzensport auch stark religiöse Menschen unterschiedlicher Religionen, als Team zusammenzuwirken. Dass migrationsbedingte Diversität jedenfalls auch christlich-religiöse Potentiale mit sich bringt, mag ein Allgemeinplatz sein, ist aber trotzdem schön.
Mehr: www.die-tagespost.de.