John Piper zeigt in dem nachfolgenden Videobeitrag auf der Grundlage vom Hohenlied der Liebe (1Kor 13), dass Liebe mehr ist als eine Entscheidung (obwohl wir das heute oft gesagt bekommen). Gleichwohl mir die Hintergrundmusik etwas auf die Nerven geht und die Liebe m.E. (indirekt) leicht übertrieben in die Nähe des Gefühlsreichtums gerückt wird, stimme ich Piper zu. Liebe ist mehr als eine Entscheidung. Sie kommt zu uns durch Gottes Sohn, als Gabe des Geistes füllt sie uns aus und bevollmächtigt uns zu Taten der Liebe.
Die Liebe, die in der Gemeinde ist, ist also aus Gott entstanden, [1. Joh] 4, io. Das Wort geht von der Tatsache aus, daß Liebe da ist und zwar Liebe zu Gott; denn nur so versteht sich der folgende verneinende Satz, er sagt, wodurch diese Liebe da ist. Liebe zu Gott entsteht nicht dadurch, daß der Mensch Gott liebt und Gott diese Liebe erwidert, sie geht nicht vom Menschen aus. Der Mensch vermag von sich aus Gott nicht zu lieben. Ein solcher Gedanke wäre für Johannes eine Verleugnung der Gottheit Gottes. Nicht der Mensch erzeugt in Gott die Liebe, sondern Gott erweckt sie im Menschen, sie geht von oben nach unten. Liebe ist für Johannes nicht etwas Menschliches, sondern etwas Göttliches. Alle menschliche Liebe ist Gegenliebe. Derselbe Gedanke wird 4, 19 ausgedrückt: wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
Die Liebe Gottes ist auch nicht durch das, was der Mensch ist, motiviert, sondern sie entspringt in Gottes eigenem Willen, er liebt, weil er Liebe ist, 4, 8. 16, oder weil er Licht ist, 1, 5, denn beides ist für Johannes dasselbe, es bedeutet: er ist nichts als Liebe. Man darf gegen diese Auffassung des Bildes nicht einwenden, daß damit etwas Selbstverständliches gesagt sei. Daß Gott Liebe ist und nichts als Güte, ist für Johannes so wenig selbstverständlich, daß es vielmehr ein Glaubensurteil ist. Diesem Bekenntnis widerspricht die Finsternis. » Da in der Welt Finsternis ist, so entspricht es dem natürlichen Gottesgedanken, auch in Gott Finsternis zu sehen. Man schließt aus dem Werk auf den Schöpfer. Dem setzt Johannes sein Bekenntnis entgegen, daß Gott nichts ist als Licht, Liebe. Das Eigentümliche des Gedankens besteht darin, daß Liebe nicht nur als Eigenschaft Gottes, als Tat Gottes, sondern als sein Wesen bezeichnet wird. Er hat und übt nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe. Liebe ist nicht eines seiner Ziele, eine seiner Eigenschaften, sondern sein ganzer Wille ist nichts als Liebe.
Der Beweis dafür liegt für Johannes nicht im Lauf der Welt, der dieses Bekenntnis eben zu widerlegen scheint. Die Liebe Gottes ist verborgen, wie Gott selbst. Offenbar geworden, in die Welt getreten, aus dem Willen zur Tat geworden ist sie durch die Sendung des einzigen Sohnes. Genau wie im Evangelium wird die Vollkommenheit der Liebe Gottes an der Vollkommenheit seiner Gabe gemessen. Johannes spricht jedoch von der Sendung des Sohnes nicht wie von einer stummen Tatsache, aus der er durch eigenen Gedanken Gottes Liebe erschlossen habe, sondern daß Gott Licht ist, das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Er nennt also auch nicht Jesu Werk, sondern sein Wort als den entscheidenden Beweis für die Liebe Gottes. Der Erweis der Liebe Gottes wird nicht in äußeren Dingen gesehen, nicht in sachlichen Gaben, überhaupt nicht in äußerer Erfahrung; vielmehr gilt als der höchste Erweis der Liebe Gottes der Name der Gotteskinder, 3, 1. Daß Johannes nur vom Namen spricht und schon in ihm die Offenbarung vollkommener Liebe sieht, zeigt, daß es ihm nur auf die Liebe Gottes und nicht auf die aus ihr folgenden sachlichen Gaben ankommt. Diese Schätzung der Liebe Gottes ist selbst wieder Liebe. Die Gotteskindschaft besteht jedoch bei Johannes nicht nur im Namen, sondern im Besitz des Geistes Gottes. In der Gabe des Geistes besteht für Johannes der höchste Erweis der Liebe Gottes. In dieser Beziehung steht die Gabe des Geistes Gottes neben der des Sohnes Gottes. Er ist insofern die höchste Gabe Gottes, als Gott mit dem Geist sich selbst gibt. Sich selbst geben, das ist nach Johannes auch für Gott die höchste Form der Liebe. Darum erkennt die Gemeinde an der Gegenwart des Geistes die Gegenwart Gottes, 3, 23f; 4, 13. Eben weil im Geist Gott im Menschen ist, so wird der Geist nicht etwa als eine Kraft geschätzt, die ihren Wert darin hätte, daß sie zu irgend einem Ziel führte, er hat seinen Wert nicht als Mittel für irgend einen über ihn hinausliegenden Zweck, sondern er ist an sich die höchste Gabe Gottes. Geist Gottes zu empfangen, ist das Ziel der Gemeinde. Dieselbe Anschauung liegt im Evangelium vor. Wen der Vater liebt, zu dem kommt er und wohnt bei ihm, 14, 23, und gegenwärtig ist er im Menschen durch den Geist, v. 17 ff. Dieses Wohnen Gottes im Menschen, welches ihn zum „Tempel“ macht, ist die Gemeinschaft mit Gott — das Ziel der Liebe Gottes, genau so wie der höchste Erweis der Liebe Gottes zu seinem Sohne darin besteht, daß er den Sohn nicht allein läßt, sondern nicht nur äußerlich bei ihm, sondern inwendig in ihm ist. Dabei liegt im Geistgedanken des Johannes niemals, wie etwa in der Mystik Philos, der Anspruch der Vermischung mit Gott. DerGeist bleibt „heilig“, d. h. göttlich, er bleibt Gottes Geist. Das ewige Leben (und das ist doch nichts anderes als der Geist), das Gott der Welt gegeben hat, ist in seinem Sohne, 1. Joh. 5, 11. Johannes denkt nicht an Vermischung des Geistes mit dem Menschen, sondern an Unterscheidung und Gemeinschaft, d. h. an Liebe.
Weil Gott sich als Liebe offenbart, so haftet bei Johannes unmittelbar an der Kenntnis Gottes Trieb und Kraft zur Liebe. Wer liebt, beweist damit, daß er Gott kennt, und wer nicht liebt, beweist, daß er ihn nicht kennt, 4, 8. Ein kraftvolleres Liebesmotiv als die Erkenntnis Gottes und eine Erkenntnis Gottes, die nicht diese Wirkung unmittelbar ‚ in sich schlösse, gibt es nicht.An den Hinweis auf die Liebe Gottes schließt Johannes nicht das Gebot der Liebe zu Gott, sondern unmittelbar das Gebot der Bruderliebe. Gott lieben heißt ihm gehorchen, seine Gebote halten, 5> 3- Liebe ist, so gut Gott wie den Menschen gegenüber, nicht Stimmung und Empfindung, sondern Tat. „Geliebte, wenn uns Gott so geliebt hat, so müssen auch wir uns unter einander lieben.“ Denselben Sinn hat das Wort 1, 7 : „Wenn wir im Lichte wandeln, so haben wir Gemeinschaft unter einander“. Aus dem Wandel in der Güte Gottes folgt die Liebe. Ebenso stehen 2, 9 der Wandel in der Finsternis, d. h. die Ge-schiedenheit von Gottes Liebe, und der Haß gegen den Bruder neben einander. Die Liebe Gottes erweckt für Johannes ohne weiteres die Liebe zu den Brüdern, freilich nicht mit Naturnotwendigkeit — denn dieser Zusammenhang kann versagen, aber damit erlischt dann auch die Gemeinschaft mit Gott. Nur wer den Bruder liebt, der bleibt auch im Licht 2, 10.
Nun aber der Beitrag von John Piper, der uns zur Quelle der Liebe und Freude führt:

 D.A. Carson erzählt in dem TGC-Beitrag
D.A. Carson erzählt in dem TGC-Beitrag 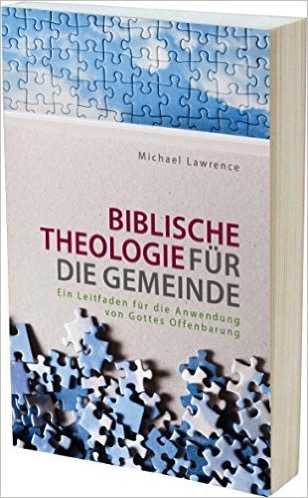 Michael Lawrence schreibt in
Michael Lawrence schreibt in