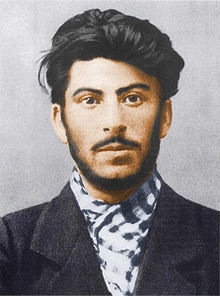Harvard-Studie bezweifelt Keynes‘ Theorie
Die Theorie, der Staat solle in Krisen mit Mehrausgaben die Privatwirtschaft stimulieren, erlebt seit 2008 eine Renaissance. Doch eine neue Studie negiert diese von John Maynard Keynes prognostizierte Wirkung. DIE ZEIT schreibt über die Studie:
„Höhere staatliche Ausgaben scheinen Aktivitäten in der Privatwirtschaft zu verdrängen“, lautet das Fazit. „Das Ausmaß dieses Effekts ist alles andere als trivial.“ So würden die Mittelzuflüsse aus Washington im Schnitt um 452 Millionen Dollar pro Jahr steigen die Investitions- und Forschungsausgaben sänken im Gegenzug um 92 Millionen Dollar.
Die Forscher hatten das so nicht erwartet. Sie wollten mit ihrer Studie nicht Keynes infrage stellen, sondern zeigen, wie politische Protektion aus Washington der lokalen Wirtschaft hilft. „Dass das durchschnittliche Unternehmen nicht profitiert, war für uns eine enorme Überraschung“, sagt Mitautor Joshua Coval.
Mehr: keynes-oekonomie-theorie.pdf.