J. Frame: Geschichte der westlichen Philosophie und Theologie
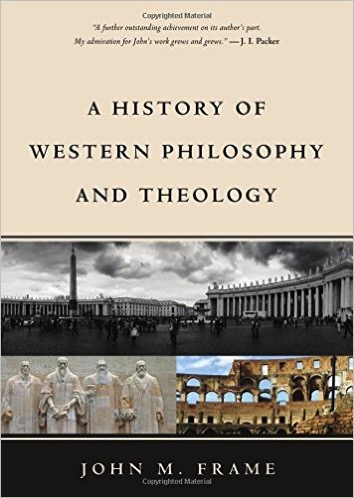 Was macht ein Buch lesenswert und hilfreich? Neben seinem Inhalt sicherlich die Tatsache, dass komplexe Dinge leicht verständlich und trotzdem nicht allzu simpel dargestellt werden.
Was macht ein Buch lesenswert und hilfreich? Neben seinem Inhalt sicherlich die Tatsache, dass komplexe Dinge leicht verständlich und trotzdem nicht allzu simpel dargestellt werden.
John Frame, Professor für Systematische Theologie und Philosophie am Reformed Theological Seminary in Orlando (USA), wird seit Jahrzehnten – über reformierte Kreise hinaus – dafür geschätzt, genau diese Art von Büchern zu schreiben. Da sind u.a. zwei Titel zur Apologetik, eine vierbändige Dogmatik (Lordship-Series), eine kürzere Systematische Theologie und neuerdings auch ein Buch zur Philosophie- und Theologiegeschichte:
- John Frame, A History of Western Philosophy and Theology, Phillipsburg: P&R Publishing, 2015, 875 S.
Zum Inhalt: Nach einem Vorwort von Albert Mohler und Frame selbst, bietet er im ersten Kapitel auf 36 Seiten eine Einführung zu den Fragen: Was ist Philosophie und wieso sollte man sich als Christ mit ihr beschäftigen? Welche größeren Teilbereiche umfasst die Philosophie (Metaphysik, Epistemologie und Ethik, wobei Frame sich auf die ersten beiden konzentriert)? In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Welche Sichtweisen bietet die Bibel zu diesen Themen? Was kann der Mensch eigentlich von sich aus wissen und was hat die Sünde damit zu tun?
In den darauffolgenden zwölf Kapiteln beschreibt Frame die unterschiedlichen Epochen, ihre einflussreichsten Vertreter, die wichtigsten Fragestellungen jener Zeit und welche biblischen Perspektiven es dazu gibt. Die Kapitel und Themenbereiche sind im Einzelnen:
- Griechische Philosophie
- Frühe christliche Philosophie
- Philosophie des Mittelalters
- Das Denken der frühen Neuzeit
- Theologie in der Aufklärung
- Kant und seine Nachfolger
- Theologie im 19. Jahrhundert
- Nietzsche, Pragmatismus, Phänomenologie und Existenzialismus
- Liberale Theologie des 20. Jahrhunderts, Teil 1
- Liberale Theologie des 20. Jahrhunderts, Teil 2
- Sprachphilosophie im 20. Jahrhundert
- Die jüngste christliche Philosophie
Damit hört Frames Buch allerdings noch nicht auf. Ab Seite 579 findet man noch einen Anhang mit 20 Ressourcen, d.h. Rezensionen zu wichtigen Büchern und Artikel zu besonderen Themen, die in den vorigen Kapiteln angerissen wurden (z.B. ontologischer Gottesbeweis, Determinismus und freier Wille, menschliche Sprache und göttliche Offenbarung, Wissen von Nichtgläubigen über Gott, usw.).
Einige Beobachtungen zum Aufbau des Buches: A History of Western Philosophy and Theology ist nicht nur äußerst klar und verständlich geschrieben, es ist auch didaktisch vorbildlich strukturiert: Auf das normale Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben folgt zur besseren Übersicht ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit allen Unterthemen (analytical outline); danach findet der Leser einen Verweis auf die dazugehörigen Vorlesungen Frames, die man gratis über iTunes nachhören kann. Am Ende gibt es ein Glossar mit Begriffserklärungen, eine kommentierte Bibliographie mit weiterführender Literatur, ein ausführliches Quellenverzeichnis der verwendeten Bücher und Onlineartikel, ein Namensverzeichnis, ein Schlagwörterverzeichnis, ein Verzeichnis der zitierten Bibelstellen und schließlich eine kurze Übersicht der großen Wendepunkte in der Geschichte der Philosophie bzw. der Theologie. Man sieht: Das Buch ist darauf ausgelegt, nicht bloß ein einziges Mal gelesen zu werden.
Auch die einzelnen Kapitel sind didaktisch gut aufgebaut: Auf jeder geraden Seitenzahl ist noch einmal der Kapitelaufbau abgedruckt und der Unterabschnitt markiert, den man gerade vor sich hat. Grafiken erleichtern das Verständnis abstrakter Konzepte; zentrale Aussagen sind am Rand noch einmal extra abgedruckt; Fotos der jeweiligen Philosophen und Theologen machen die bloßen Namen lebendiger. Immer wieder erinnert Frame auch an die Inhalte der vorherigen Kapitel, um thematische Querverbindungen und manchen roten Faden nachzuzeichnen. Am Ende eines jeden Kapitels sind noch einmal die behandelten Themen als Schlagworte aufgelistet, zusätzlich gibt es eine Liste mit Fragen zur Wiederholung und Vertiefung des Gelesenen, ebenso eine kommentierte Bibliographie mit Büchern, Onlineressourcen und Primärquellen zum jeweiligen Kapitel, sowie eine Auflistung wichtiger Zitate. Für weitere Artikel und vertiefende Exkurse verweist Frame stets auf die jeweiligen Kapitel seiner Lordship-Series und auf seine Homepage, die er zusammen mit seinem Kollegen, dem Neutestamentler Vern Poythress führt.
Was sind Schwachpunkte von A History of Western Philosophy and Theology? Zwar ist der Band durchaus umfassend, doch kann er letztlich nur ein Überblick bzw. eine solide Einführung sein. Denn wer auf knapp 580 Seiten eine Geschichte der westlichen Philosophie und Theologie vorlegen möchte, muss sich zwangsläufig auf eine Auswahl beschränken. Daher ist Frames Buch längst nicht so ausführlich wie Störigs Klassiker Kleine Weltgeschichte der Philosophie dem jedoch die biblisch-theologische Perspektive fehlt. Einzelne Schlüsselfiguren und ihre Denksysteme untersucht Frame eingehend auf mehreren Seiten (z.B. Augustinus, Thomas von Aquin, Kant, Schleiermacher, Barth, Pannenberg und auch Moltmann), andere Denker und Strömungen werden wiederum relativ kurz abgehandelt (z.B. Luther, Calvin und die Reformation). Römisch-katholische oder orthodoxe Denker kommen höchstens am Rande vor.
Obwohl Frames Darstellungen der ausgewählten Philosophen und Theologen stets nachvollziehbar und gehaltvoll sind, folgt er in der Regel der Mehrheitsmeinung der Forschung. In der Auswertung untersucht er zentrale Schwachpunkte und unbiblische Gedankengänge der einzelnen Denker und Strömungen, konzentriert sich dabei aber immer auf das Wesentliche. Leser mit Vorwissen hätten sich da wahrscheinlich etwas mehr Ausführlichkeit gewünscht.
Grundsätzlich stützt sich Frame auf die vollkommene Verlässlichkeit und Irrtumslosigkeit der Bibel als Gottes Wort, darüber hinaus nutzt er den Ansatz der voraussetzungsbewussten Apologetik (presuppositionalism) im Sinne von Cornelius Van Til (siehe hier). Trotz hilfreicher Erklärungen hätte mancher Leser auch hier detailliertere Begründungen erwartet, warum gerade dieser Ansatz der Apologetik – obwohl äußerst passend und sinnvoll – die richtige Lesebrille für den Rest des Buches bietet.
Letztlich merkt man in seiner Argumentation, dass Frame vor allem Systematischer Theologe ist und die Exegese bei ihm bereits vorher im Hintergrund stattgefunden hat. Wie auch in seinen anderen Bücher nutzt er ausführlich sein Modell der Lordship-Theologie, um verschiedene, „dreifaltige“ bzw. „drei-polige“ Verständnishilfen zu entwickeln: Ausgehend von Gottes trinitarischem Charakter offenbart er sich „drei-polig“ in seiner Autorität, Macht und Gegenwart. Jegliches Wissen des Menschen als Gottes Geschöpf und Diener sieht Frame ebenfalls auf drei Ebenen (normativ, situativ und existenziell). Dann wiederum nutzt er vier-polige Konzepte, um biblische Denkmuster mit unbiblischen zu vergleichen (z.B. Gottes Transzendenz und Immanenz gegenüber Wittgensteins perfekter Sprache und seinem Konzept des Mystischen). So didaktisch wertvoll diese drei- und vier-poligen Verständnishilfen auch sein mögen, an manchen Stellen wirken sie etwas willkürlich und abstrakt.
Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis offenbart einen ungewöhnlichen Schwerpunkt, den ich persönlich jedoch nicht als Manko wahrgenommen habe: Frame bietet den letzten 300 Jahren der Philosophie- und Theologiegeschichte außergewöhnlich viel Raum und zeigt, welche gedankliche Basis hinter den Themen und Fragen steckt, die uns gerade heute relevant erscheinen.
Zugegeben – viele einflussreiche Denker werden nicht behandelt (z.B. J. Butler, M. Nussbaum, J. Habermas), u.a. weil sie in der philosophischen Ethik arbeiten, die Frame hier nicht schwerpunktmäßig behandelt. Und der Postmoderne gesteht Frame wie selbstverständlich nur 2,5 Seiten zu. Trotzdem weist er nach, wo unsere heutigen Fragen, Ideologien und „Erkenntnisse“ herkommen, auf welche Theorien sie aufbauen und dass sie oft gar nicht so revolutionär sind, wie wir vielleicht dachten. Augenöffner sind auf jeden Fall die Kapitel zur Liberalen Theologie in ihren unterschiedlichen Ausführungen, aber auch Frames konstruktiv-kritische Kommentare zu den mittlerweile zahlreichen christlichen Philosophen unserer Zeit. Das macht A History of Western Philosophy and Theology letztlich unglaublich „aktuell“.
Welches Fazit bleibt? John Frames Buch ist nicht perfekt, dafür aber äußerst lesenswert und hilfreich. Wer solide Englischkenntnisse mitbringt, wird auf den ersten Blick eine gut verständliche Einführung in das philosophische und theologische Denken der westlichen Welt vorfinden und auf viel Stoff zum Weiterdenken stoßen. Ich würde das Buch jederzeit Hauptamtlichen im christlichen Dienst empfehlen, weil es ihre Arbeit und auch die missionarische Verkündigung ohne Frage stärken wird. Ebenso werden engagierte Ehrenamtliche in der Gemeindearbeit und Studierende unterschiedlicher Studienrichtungen (Geschichte, Soziologie, Theologie, Philosophie, Lehramt allgemein, usw.) von dem Buch profitieren.
Auf den zweiten Blick hingegen ist A History of Western Philosophy and Theology ein Weckruf und Ansporn. John Frame zeigt auf bescheidene und zugleich direkte Art und Weise: Gottes verlässliches und unfehlbares Wort vermag den philosophisch-kritischen Anfragen der Menschheit nicht nur standzuhalten, sondern bietet selbst das tragfähigste Weltbild. Wer sich im Gegensatz dazu von postmodernen, liberal-christlichen oder entschieden nichtchristlichen Konzepten Antworten erhofft, wird mehr als enttäuscht werden. Alles in allem also ein wichtiges Buch, das hoffentlich bald in deutscher Sprache erscheint und vielen weiterhelfen wird, das Evangelium von Jesus Christus treu und „vernünftig“ weiterzugeben.
Daniel Vullriede
 500 Jahre nach der Reformation wird dem Christentum häufig die rationale und geschichtliche Grundlage abgesprochen. Kritiker behaupten, die Ereignisse, die uns die Evangelien berichten, hätten nie oder zumindest ganz anders als überliefert, stattgefunden. Das Neue Testament ist ihrer Meinung nach tendenziös geschrieben und geordnet und deshalb nicht vertrauenswürdig.
500 Jahre nach der Reformation wird dem Christentum häufig die rationale und geschichtliche Grundlage abgesprochen. Kritiker behaupten, die Ereignisse, die uns die Evangelien berichten, hätten nie oder zumindest ganz anders als überliefert, stattgefunden. Das Neue Testament ist ihrer Meinung nach tendenziös geschrieben und geordnet und deshalb nicht vertrauenswürdig.
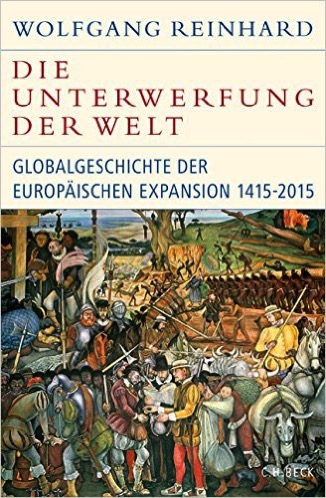 Der Historiker Wolfgang Reinhard, emeritierter Professor für Neue Geschichte an der Universität Freiburg, ist ausgewiesener Experte für die Geschichte der Päpste und der Konfessionalisierung. In den achtziger Jahren veröffentlichte er eine viel beachtete Geschichte der europäischen Expansion in vier Bänden (Stuttgart: Kohlhammer, 1983–1990). 2001 erhielt er den renommierten Historikerpreis (Preis des Historischen Kollegs).
Der Historiker Wolfgang Reinhard, emeritierter Professor für Neue Geschichte an der Universität Freiburg, ist ausgewiesener Experte für die Geschichte der Päpste und der Konfessionalisierung. In den achtziger Jahren veröffentlichte er eine viel beachtete Geschichte der europäischen Expansion in vier Bänden (Stuttgart: Kohlhammer, 1983–1990). 2001 erhielt er den renommierten Historikerpreis (Preis des Historischen Kollegs).