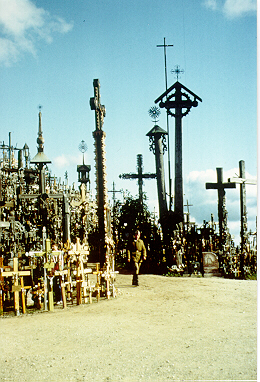Bettina Röhl: Darkrooms in den Grundschulen?
Bettina Röhl zeigt in ihrem Artikel „Der Philo-Pädophilismus der Grünen 2013“, dass die Aufarbeitung von systemischen Irrtümern der GRÜNEN gerade erst am Anfang steht. Was uns in der Politik hinsichtlich der schulischen Sexualaufklärung oder der geschlechtlichen Gleichberechtigung permanent eingetrichtert oder von oben verordnet wird, ist zutiefst verwoben mit linken Utopien und Menschenbildern. „Ideen leben eben länger und falsche Ideen besonders.“
Da lohnt es sich doch, neu über die Reformpolitik der letzten 40 Jahren nachzudenken!
Nun aber Bettina Röhl:
Darkrooms, pantomimisch öffentlich dargestellter Koitus und Orgasmus oder ein Outing als Schwuler im normalen Grundschulunterricht von Kindern, die einen realen Orgasmus oder Koitus noch nie erlebt habe, ist heute im Jahr 2013 gelebter Kindesmissbrauch auf schulpolitischer Ebene. Ersonnen von Leuten, die von der glorreichen pädophilen Vergangenheit im Zweifel noch heute infiziert sind. Allerdings: Jeder Idiot weiß, dass Kinder, die man in Zweisamkeiten hineinredet, schon in sehr jungen Jahren entgleiste Verhältnisse zueinander aufbauen. Da gibt es sofort Sieger und Besiegte und wenn es genital wird, um so mehr. Eine solche Idee vom Kinderpuff in der Kita, um es so drastisch auszudrücken, wie es in Wahrheit ist, sind zweifelsfrei durch das pädophile Erbe der Grünen aus deren früheren Jahren mit initiiert. Ideen leben eben länger und falsche Ideen besonders. Das ist eine große Crux der Demokratie.
Auch die bei den Grünen fest im System verankerte Frauenemanzipation, schleppt einen tonnenschweren Makel mit sich herum. Ob Genderrecht oder Emanzipationsgesetz heute oder Gleichberechtigungsforderung vielfältiger Art früher: Die bewegten Frauen, besonders auch bei den Grünen haben sich selbstsüchtig und übersteigert mit sich selbst befasst. Aber um die geschändeten und die missbrauchten Kindern haben sich die Frauen in der Bewegung, die zugeguckt haben, in schändlicher Weise nicht gekümmert.
Im Gegenteil: Sie haben mitgemacht. Bestenfalls in Sorgerechtsstreitigkeiten, wo es galt den Männern eins auszuwischen, haben Frauen das Kindeswohl als Waffe entdeckt. Die bewegten Frauen haben sich regelmäßig diametral anders verhalten, als die überwiegend große Zahl der Frauen und Mütter, die von dem grünen Virus nicht befallen sind.
Hier: www.wiwo.de.