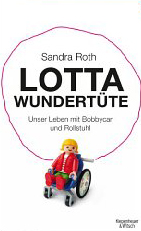Die 28. Auflage des Nestle-Aland (NA28) ist seit einigen Monaten auf dem Markt (siehe hier). Das neue Griechische Testament bietet einen überarbeiteten textkritischen Apparat und integriert die bisherigen Ergebnisse der Arbeit an der „Editio Critica Maior“ (ECM).
Die ECM ist eine umfängliche kritische Ausgabe des griechischen Neuen Testaments, die vom Institut für Neutestamentliche Textforschung in Münster verantwortet wird. Bis 2030 soll das Projekt, das von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften subventioniert wird, abgeschlossen sein. Die Untersuchung der sogenannten „Katholischen Briefen“ (Jakobusbrief, Petrusbriefe, Johannesbriefe, Judasbrief) ist sehr weit fortgeschritten und wurde deshalb in der 28. Ausgabe des Novum Testamentum Graece berücksichtigt (siehe dazu hier: www-user.uni-bremen.de).
Der Grundtext hat sich gegenüber der 27. Auflage an insgesamt 34 Stellen geändert. Die meisten Revisionen sind von geringfügiger Bedeutung. Eine Liste mit allen Änderungen zwischen NA27 und NA28 gibt es bei Bibel-Works.
Eine NA28-Lesart ist allerdings bemerkenswert und so möchte ich kurz darauf eingehen. Es betrifft den Judasbrief, der – dies nebenbei – meines Erachtens heute zu wenig Beachtung findet (Wer hat mal eine Predigt zum Judasbrief gehört?).
Worum geht es? In den meisten deutschsprachigen Ausgaben heißt es in Judas 1,3–9 (Züricher Übersetzung):
„Es haben sich nämlich gewisse Leute bei euch eingeschlichen, über die das Urteil in der Schrift schon lange voraus gefällt wurde: Gottlose sind sie, die die Gnade unseres Gottes ins Gegenteil verkehren, in bare Zügellosigkeit, und die den einzig wahren Herrscher, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ich will euch — obwohl ihr dies alles schon wisst — daran erinnern, dass der Herr das Volk zwar ein für alle Mal aus dem Land Ägypten gerettet, die aber, die ihm ein zweites Mal keinen Glauben schenkten, der Vernichtung preisgegeben hat. Auch die Engel, die die Grenzen ihres Herrschaftsbereichs nicht eingehalten hatten, sondern ihre Wohnstätte verließen, hält er mit ehernen Fesseln in der Unterwelt fest für den großen Tag des Gerichts. Ja, Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die auf ähnliche Weise Unzucht getrieben haben und andersartigem Fleisch hinterhergelaufen sind, stehen als abschreckendes Beispiel vor aller Augen: Sie erleiden die Strafe ewigen Feuers. Auf ähnliche Weise freilich beschmutzen auch diese Träumer das Fleisch, sie missachten die Autorität des Herrn und lästern die himmlischen Majestäten.“
Mir geht es um den Vers 1,5: „Ich will euch — obwohl ihr dies alles schon wisst — daran erinnern, dass der Herr das Volk zwar ein für alle Mal aus dem Land Ägypten gerettet, die aber, die ihm ein zweites Mal keinen Glauben schenkten, der Vernichtung preisgegeben hat.“
Egal, ob die deutschen Übersetzungen auf dem Textus receptus oder auf dem NA26/NA27 beruhen: der HERR hat sein Volk aus dem Land Ägypten gerettet (NA27: πάντα ὅτι [ὁ] κύριος ἅπαξ). Im NA28 heißt es nun, dass Jesus sein Volk aus dem Land Ägypten gerettet hat (N28: ἅπαξ πάντα ὅτι Ἰησοῦς).
Das Komitee, das den Text des NA26 bzw. des Greek New Testaments verantwortete, war sich dessen bewusst – wie Bruce M. Metzger in seinem textkritischen Kommentar hinsichtlich der Urteilsfindungen erhellend schreibt (A Textual Commentary on the Greek New Testament, 1975, S. 723–724) –, dass die Lesart „Jesus“ durch Handschriften stärker bezeugt ist (A, B, 33, 81, 322, 323, 434, …). Dennoch hat sich eine Expertenmehrheit gegen die Lesart entschieden, weil sie als theologisch schwierig bis unmöglich gilt und der Autor des Judasbriefes den Namen „Jesus“ sonst immer nur in Verbindung mit „Christus“ verwendet (vgl. Judas 1,1.4.17.21.25). Streng genommen hat die Kommission damit gegen eine Regel verstoßen, die sie sonst selbst lehrt, nämlich dass im Zweifel die schwierigere Lesart vorzuziehen sei (lectio difficillior).
Der NA28 wählt nun das stärker bezeugte „Jesus“, welches sich übrigens schon in der lateinischen Vulgata findet. Die ESV, die auf einer kritischen Rezeption des NA27 beruht, hatte sich bereits 2001 für die Variante mit Ἰησοῦς entschieden und übersetzt: „… Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe.“
Einerseits fällt diese Lesart nicht sonderlich ins Gewicht. Schon in Vers 4 bezeichnet Judas (vgl. 1,1) diejenigen, die den einzig wahren Herrscher, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen, als Gottlose. Da Jesus dort „Herr“ genannt wird (κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν), liegt es auf der Hand, dass „Herr“ (κύριος) in Vers 5 ebenfalls auf den präexistenten Jesus verweist. Insgesamt bezeichnet Judas sogar vier Mal Jesus als „Herrn“ (V. 1,4.17.21.25). Hinzu kommt, dass die Verfasser neutestamentlicher Schriften außerhalb alttestamentlicher Zitate eher selten mit dem Begriff „Herr“ auf Gott referenzieren.
Andererseits ist die Aussage von V. 5 univok trinitarisch, wenn dort tatsächlich „Jesus“ zu lesen ist. Vergegenwärtigen wir uns kurz den Zusammenhang.
Judas ermahnt seine Leser, für den einen Glauben zu kämpfen, der „den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist“ (V. 3). Es gibt etliche Leute, die die Gnade Gottes mit Zügellosigkeit vertauschen und Gott als Herrscher verleugnen. Um zu zeigen, dass auf die Verführer das Gericht wartet, erinnert Judas an den Auszug aus Ägypten (V. 5), auf Engel, die ihre Kompetenzen überschritten haben (V. 6) und auf die sexuelle Unmoral in Sodom und Gomorra sowie in den umliegenden Städten (V. 7). So, wie diese Ungehorsamen das Gericht trifft, wird auch die Verführer, die sich in die Gemeinden einschleichen, das Gericht treffen.
Im ersten Beispiel rettet Gott sein auserwähltes Volk aus Ägypten und vernichtet diejenigen, die ihm nicht vertrauten. Das ist ein Verweis auf 4 Mose 14,20–24, wo es heißt:
„Doch so wahr ich lebe und die ganze Erde der Herrlichkeit des HERRN voll werden soll: Alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und die mich nun schon zehnmal auf die Probe gestellt und nicht auf meine Stimme gehört haben, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren zugeschworen habe, und alle, die mich verachten, werden es nicht sehen. Meinen Diener Kaleb aber, bei dem ein anderer Geist war und der treu zu mir gehalten hat, werde ich zum Lohn dafür in das Land bringen, in dem er gewesen ist, und seine Nachkommen sollen es in Besitz nehmen.“
Die große Volkesmenge missachtet das Wirken Gottes und wird deshalb vom Einzug ins verheißene Land ausgeschlossen. Nur Kaleb und Josua nehmen das Land ein, da sie sich vom Geist Gottes leiten ließen und treu waren.
Das zweite Beispiel geht wahrscheinlich auf 1Mose 6 zurück. Die Engel haben unberechtigterweise ihren Herrschaftsbereich verlassen und werden „in Fesseln der Finsternis“ im Abgrund für das endgültige Gericht aufbewahrt (vgl. 2Petr 2,4).
Wer ist nun derjenige, der die Israeliten aus der Gefangenschaft errettete und die Ungehorsamen der Vernichtung preisgab? Wer hält die Engel mit ehernen Fesseln in der Unterwelt fest für den großen Tag des Gerichts? Gemäß der NA28-Lesart führt kein Weg an demjenigen vorbei, der eines Tages kommen wird, um „Lebende und Tote zu richten“ (2Tim 4,1): Jesus.