Ich wundere mich schon den ganzen Tag darüber, dass der Beitrag über die Radikalisierung der Wort+Geist-Bewegung überdurchschnittlich oft aufgerufen wird. Die Erklärung ist einfach: Das ZDF-Magazin Frontal 21 hat gestern über die »Erweckungsbewegung« berichtet. Idea schreibt:
Am 13. August berichtete das Magazin über die umstrittene Glaubensgemeinschaft „Wort+Geist“ (Röhrnbach/Niederbayern). Wie die Moderatorin des Magazins, Hilke Petersen, sagte, befänden sich christliche Freikirchen im Aufschwung. Sie nähmen die Bibel einschließlich der darin geschilderten Wunder »wortwörtlich«. Eine dieser »neureligiösen Glaubensgemeinschaften« sei die Bewegung »Wort+Geist«, deren Zentrum sich in Röhrnbach (Niederbayern) befindet. Dort werde Heilung von schweren Krankheiten durch Handauflegen versprochen. Das könne »richtig gefährlich werden«, so
Petersen.
Die Wort+Geist-Bewegung hat mit einer protestantischen Kirche nichts gemein und muss in der Tat als gefährlich bezeichnet werden. Ich hoffe und bete, dass möglichst viele der von Helmut Bauer und seinen Mitarbeitern verführten Menschen den Weg in die Freiheit zurückfinden.
Wer an diesem Urteil zweifelt, lese den oben erwähnten Beitrag sowie die dazugehörigen Kommentare und höre sich folgende O-Ton-Mitschnitte an: www.youtube.com.
Zu denken, ein Christ müsse den Verstand ausschalten, ist ein tragisches Missverständnis. Gott will, wie Paulus es im 12. Kapitel des Römerbriefes schreibt, ja gerade unser Denken erneuern. Also, ihr lieben Freunde: Wacht auf und erinnert euch daran, dass »falsche Lehrer auftreten, die heimlich gefährliche Lehren einführen« (2Petr 2,1).
 Es tut sich etwas im deutschsprachigen Europa. Sebastian Heck hat die Internetseite für die »Heidelberger Konferenz für reformierte Theologie 2010« freigeschaltet. Die Konferenz will reformatorische Christen aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Großbritannien, den U.S.A. sowie aus anderen Länder zusammenbringen und:
Es tut sich etwas im deutschsprachigen Europa. Sebastian Heck hat die Internetseite für die »Heidelberger Konferenz für reformierte Theologie 2010« freigeschaltet. Die Konferenz will reformatorische Christen aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Italien, Frankreich, Großbritannien, den U.S.A. sowie aus anderen Länder zusammenbringen und:
 The Washington Post hat einen Artikel von Mark Driscoll publiziert. Mark schreibt, wie zu erwarten, sehr deutlich:
The Washington Post hat einen Artikel von Mark Driscoll publiziert. Mark schreibt, wie zu erwarten, sehr deutlich: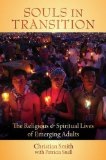

 Eine neue Ausgabe von Glauben und Denken heute ist erschienen. Enthalten sind folgende Beiträge:
Eine neue Ausgabe von Glauben und Denken heute ist erschienen. Enthalten sind folgende Beiträge: John Piper war seit 35 Jahren, als er in München bei Leonhard Goppelt u. Georg Kretschmar (nicht Wolfgang Pannenberg) promovierte, nicht mehr in Deutschland. Auf die Vorträge, die er vergangene Woche auf der Hirten-Konferenz in Bonn hielt, hat er sich sehr gefreut.
John Piper war seit 35 Jahren, als er in München bei Leonhard Goppelt u. Georg Kretschmar (nicht Wolfgang Pannenberg) promovierte, nicht mehr in Deutschland. Auf die Vorträge, die er vergangene Woche auf der Hirten-Konferenz in Bonn hielt, hat er sich sehr gefreut.