Anselm Grün: Gott braucht keine Sühne
Manche Leute meinen, Pater Dr. Anselm Grün würde das christliche Evangelium sanft umdeuten. Wer den Vortrag „Tod und Auferstehung Jesu als Bild christlicher Hoffnung“ gehört hat, sollte verstehen können, dass er das Evangelium nicht sanft, sondern wesentlich umdeutet. Verlorengehen heißt für ihn, sich selbst verlieren, Tod und Auferstehung ist das Geheimnis unseres Lebens, Golgatha befreit mich von den Erwartungen anderer, erlaubt, dass ich „Ich“ sein kann. Ostern heißt, dass wir aufstehen aus dem Grab unserer Angst und Zuschauerrolle. Und so weiter. Nach Anselm Grün ist der Tod am Kreuz keine stellvertretende Sühne, sondern Veranschaulichung und Vollendung der Liebe Gottes. Leider muss man es so sagen: Was Grün verkündigt, ist ein Pseudoevangelium.
Musste Jesus sterben, um uns Rettung zu bringen? Die Schrift sieht das anders als Pater Grün.
Während wir daran gewöhnt sind, davon zu sprechen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat (vgl. Apg 4,10; 5,30), macht es uns gewisse Schwierigkeiten, zu akzeptieren, dass die Kreuzigung ebenso Gottes Bestimmung war. Dabei spricht die Bibel durchaus davon, dass in der Kreuzigung Gott seinen Sohn in den Tod gegeben hat und er sterben musste. Während wir auf der einen Seite daran festhalten, dass die Menschen durch ihre Sünde den unschuldigen Sohn ans Kreuz gebracht haben, halten wir Golgatha zugleich auch für ein Heilstat Gottes.
Einige Beispieltexte. Ein sehr starker Text ist Röm 8,32:
Er [Gott, vgl. V. 31], der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?
Apg 2,23 spricht davon, dass Jesus von Nazareth gemäß Gottes „unumstößlichem Ratschluss“ (griech. ὡρισμένῃ βουλῇ, ōrysmenē boulē) getötet werden musste. Jesus starb folglich, weil Gott es so geplant hat. In Apg 2,22–24 lesen wir:
Israeliten, hört diese Worte: Jesus von Nazaret, einen Mann, der sich vor euch als Gesandter Gottes ausgewiesen hat durch machtvolle Taten und Wunder und Zeichen, die Gott – wie ihr selbst wisst – mitten unter euch durch ihn getan hat, ihn, der nach Gottes unumstößlichem Ratschluss und nach seiner Voraussicht preisgegeben werden sollte, habt ihr durch die Hand gesetzloser Menschen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt und aus den Wehen des Todes befreit, denn dass er in dessen Gewalt bleiben könnte, war ja unmöglich.
In Apg 4,28 erklärt gemäß dem lukanischen Bericht die Gemeinde in einem gemeinsamen Gebet, dass Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel getan haben, was Gottes Hand und „Ratschluss zuvor bestimmt hatte, damit es geschehen sollte“.
Auch die Leidensankündigungen in den Evangelien sprechen davon, dass Jesus leiden musste. In Mk 8,31 schreibt der Evangelist über Jesus:
Und er begann sie zu lehren: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten und den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen.
Markus gebraucht für das „Muss“ seines Totes das griechische δεῖ (dei), welches eine Notwendigkeit bezeichnet. Das Verbum steht für eine göttliche, unabwendbare Bestimmung (vgl. Bauer, WB6, Sp. 343 u. EWNT, Bd. 1, Sp. 668–671. Siehe auch die Untersuchung: W. J. Bennett, „The son of man must …“, in: Novum Testamentum 17 (1975), Nr. 2, S. 113–129). In den dann folgenden Leidensankündigungen gebraucht Markus das passivum divinum und drückt damit aus, dass Jesus von Gott dahingeben wurde (vgl. Mk 9,31; 10,33).
Bei Lukas ist die Rede von der Notwendigkeit des Leidens und Sterbens Jesus ebenfalls zu finden. Bevor der Menschensohn wiederkommt, „muss [griech. δεῖ, dei] er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht“ (Lk 17,25). „Der Menschensohn muss [griech. δεῖ, dei]“ – lesen wir in Lk 24,7 – „in die Hände von sündigen Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen.“
Im Johannesevangelium ist ähnlich von einem „Muss“ des Erhöhtwerdens des Menschensohnes die Rede. Joh 3,13–15 sagt beispielsweise:
Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss [griech. δεῖ, dei] der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat.
Dass die Erhöhung die Kreuzigung einschließt, wird anhand von Joh 12,32–33 offensichtlich. Der Evangelist zitiert und kommentiert dort eine Rede Jesu:
Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde weggenommen und erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das aber sagte er, um anzudeuten, welchen Tod er sterben sollte.
Dieses „Muss“ des Sterbens erschließt sich uns noch tiefer, wenn wir erkennen, dass hier an die alttestamentliche Leidensapokalyptik angeknüpft wird. Jesu Tod ist schriftgemäß, da er schon im Alten Testament ankündigt ist. So spricht Mt 26,24 davon, dass der Sohn des Menschen dahingeht, „wie von ihm geschrieben wird“. Bei seiner Verhaftung begründet Jesus gegenüber den Jüngern die Gewaltlosigkeit mit der Aussage: „Doch wie würden dann die Schriften in Erfüllung gehen, nach denen es so geschehen muss?“ (Mt 26,54).
Lukas berichtet in seinem Evangelium, das schon im Gesetz, bei den Propheten und in den Psalmen darüber geschrieben ist, dass der Menschensohn sterben muss. In Lk 24,44–48 ist zu lesen (vgl. 9,22–23):
Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch mit euch zusammen war: Alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Dann öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen: So steht es geschrieben: Der Gesalbte wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen, und in seinem Namen wird allen Völkern Umkehr verkündigt werden zur Vergebung der Sünden – in Jerusalem fängt es an –, und ihr seid Zeugen dafür.
Den Jüngern von Emmaus erklärte der auferstandene Christus (Lk 24,25–27):
Da sagte er zu ihnen: Wie unverständig seid ihr doch und trägen Herzens! Dass ihr nicht glaubt nach allem, was die Propheten gesagt haben! Musste der Gesalbte nicht solches erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht.
Als Paulus und Silas auf der zweiten Missionsreise in Thessalonich ankamen, predigte der Apostel auf der Grundlage alttestamentlicher Schriften und sagte (Apg 17,2–3):
Er öffnete ihnen die Augen und legte ihnen dar, dass der Gesalbte leiden und von den Toten auferstehen musste, und er sagte: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Gesalbte!
Auf welche alttestamentlichen Ankündigungen beruft sich Jesus hier? Der Befund ist so umfangreich, dass ich nur einige wenige Stellen nennen kann. Im Blick auf das Leiden es Menschensohnes am Kreuz ist Ps 22 sehr bedeutsam. In Psalm 22,2–3 lesen wir als Ankündigung der Gottesferne bei der Kreuzigung (vgl. Mt 27,46; Mk 15,34):
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meiner Rettung, den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du antwortest nicht, bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe.“
Schon im Gesetz, also bei Mose, sind Hinweise auf den Tod des unschuldigen Menschensohnes zu finden. In Gal 3,13 teilt Paulus uns mit, dass Christus, obwohl unschuldig, den Tod eines Verbrechers am Holz starb. Hier erfüllt sich, was wir schon in 5Mose 21,22–23 vernehmen:
„Und wenn jemand ein todeswürdiges Verbrechen begeht und er getötet wird und du ihn an einen Pfahl hängst, darf sein Leichnam nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du musst ihn noch am selben Tag begraben. Denn ein Gehängter ist von Gott verflucht, …“
Jesu Tod ist also kein „Zufall, Missgeschick oder Betriebsunfall“, sondern in den Schriften angekündigte Tat Gottes. Deshalb schreibt Paulus den Korinthern in 1Kor 15,3:
Denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, was auch ich empfangen habe: dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften, …
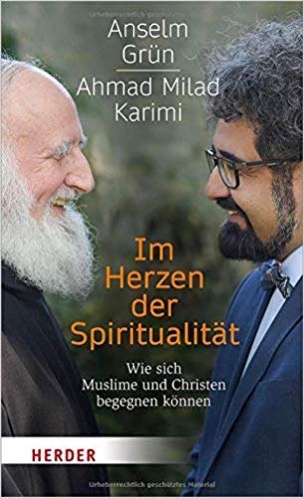
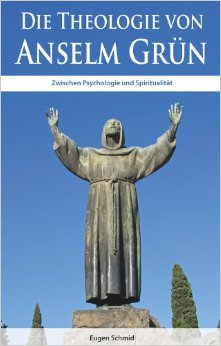 Grün, so schreibt der Autor, «psychologisiert die christliche Botschaft». Laut Grün sind wir zusammengesetzt aus Gegensätzen, die wir annehmen müssten. So würden wir dann «eins werden mit dem ganzen Kosmos». Eugen Schmid zeigt brillant auf, dass im Zentrum von Grüns Lehre die Innenschau (Esoterik) und der Mensch stehen. Indem Grün Gott im Innern zentriert, überhöht er die menschliche Natur. Nicht die Entfremdung von Gott sei die Schuld des Menschen, sondern die Entfremdung von sich selbst. So wird Jesu Tat am Kreuz bei Grün auf eine innerweltliche Ebene der Vergebung reduziert. Er spricht nicht von Jesus als Erlöser, sondern von einem, der uns innen erleuchten soll. Damit verkündet er einen anderen «Christus», der mit dem Jesus Christus, von dem die Bibel erzählt, nicht mehr viel zu tun hat. Schmids Buch ist übersichtlich gegliedert in Themen wie unter anderem «Die Frage des Bösen», «Liebe», «Himmel», «Demut», «Vergebung», «Erlösung». Mit vielen Zitaten Grüns untermauert der Autor seine Thesen und zeigt die Wurzeln von Grüns Denken, besonders mit Blick auf die Tiefenpsychologie, auf.
Grün, so schreibt der Autor, «psychologisiert die christliche Botschaft». Laut Grün sind wir zusammengesetzt aus Gegensätzen, die wir annehmen müssten. So würden wir dann «eins werden mit dem ganzen Kosmos». Eugen Schmid zeigt brillant auf, dass im Zentrum von Grüns Lehre die Innenschau (Esoterik) und der Mensch stehen. Indem Grün Gott im Innern zentriert, überhöht er die menschliche Natur. Nicht die Entfremdung von Gott sei die Schuld des Menschen, sondern die Entfremdung von sich selbst. So wird Jesu Tat am Kreuz bei Grün auf eine innerweltliche Ebene der Vergebung reduziert. Er spricht nicht von Jesus als Erlöser, sondern von einem, der uns innen erleuchten soll. Damit verkündet er einen anderen «Christus», der mit dem Jesus Christus, von dem die Bibel erzählt, nicht mehr viel zu tun hat. Schmids Buch ist übersichtlich gegliedert in Themen wie unter anderem «Die Frage des Bösen», «Liebe», «Himmel», «Demut», «Vergebung», «Erlösung». Mit vielen Zitaten Grüns untermauert der Autor seine Thesen und zeigt die Wurzeln von Grüns Denken, besonders mit Blick auf die Tiefenpsychologie, auf.
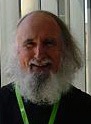 Der Benediktinerpater Anselm Grün, viel gelesener Autor spiritueller Bücher und beliebter Lebensberater schreibt in seinem Buch Erlösung (Kreuz Verlag, 2004, S .7) über das Sühneopfer von Jesus Christus:
Der Benediktinerpater Anselm Grün, viel gelesener Autor spiritueller Bücher und beliebter Lebensberater schreibt in seinem Buch Erlösung (Kreuz Verlag, 2004, S .7) über das Sühneopfer von Jesus Christus: