Nachfolgend eine Rezension zu:
Blaise Pascal. Briefe I: Die private Korrespondenz
 Der französische Mathematiker, Theologe und Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) gilt als Wunderknabe. Als Zwölfjähriger überraschte er seinen Vater, indem er auf dem Küchenboden selbständig die ersten 32 Lehrsätze der euklidischen Geometrie herleitete. Im Alter von 19 Jahren erfand er die erste mechanische Addiermaschine. Sieben Jahre später stellte er bereits den Pascalschen Satz auf, der besagt, dass in Flüssigkeiten der Druck gleichmäßig in alle Richtungen verteilt wird. Überdies gilt er heute als Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Der französische Mathematiker, Theologe und Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) gilt als Wunderknabe. Als Zwölfjähriger überraschte er seinen Vater, indem er auf dem Küchenboden selbständig die ersten 32 Lehrsätze der euklidischen Geometrie herleitete. Im Alter von 19 Jahren erfand er die erste mechanische Addiermaschine. Sieben Jahre später stellte er bereits den Pascalschen Satz auf, der besagt, dass in Flüssigkeiten der Druck gleichmäßig in alle Richtungen verteilt wird. Überdies gilt er heute als Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Pascals Vater unternahm viel, um seine Kinder zu fördern. Er selbst erlitt 1646 auf einer Reise eine schwere Verletzung, so dass er mehrere Monate ans Bett gefesselt war. In dieser Zeit kümmerten sich zwei gläubige Christen fürsorglich um ihn. Sie waren es, die die gesamte Familie mit dem sogenannten Jansenismus bekannt machten. Der Name geht auf Cornelius Jansen (1585–1638) zurück. Jansen stand unter dem Einfluss von Augustinus und lehrte, dass ein Sünder keinen Einfluss auf seine Erlösung habe, sondern ganz dem göttlichen Gnadenwillen ausgeliefert sei. Die erweckliche Bewegung breitete sich in Frankreich und den Niederlanden innerhalb der katholischen Kirche aus. Besonders die Jesuiten nahmen jedoch daran Anstoß und bekämpften die Bewegung entschlossen.
Die Bekanntschaft mit dem Jansenismus löste bei Blaise Pascal eine erste Bekehrung aus. Etliche Jahre später folgte ein Erweckungserlebnis, das auch als zweite Bekehrung bezeichnet wird. Nach einem schweren Unfall mit seiner mehrspännigen Pferdekutsche, den wie durch ein Wunder alle Beteiligten überlebten, wurde ihm am 23. November des Jahres 1654 plötzlich klar, dass Gott sein ganzes Herz wollte. Nach seinem Tod entdeckt sein Diener ein in seinem Rock eingenähtes „Mémorial“. Dort steht geschrieben: „… Das ist aber das ewige Leben, da sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Jesus Christus! Jesus Christus! Ich habe mich von ihm getrennt, ich habe ihn geflohen, mich losgesagt von ihm, ihn gekreuzigt. Möge ich nie von ihm geschieden sein. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man ihn bewahren. Vollkommene und liebevolle Entsagung …“ (B. Pascal, Pensées, 1937, S. 248). Von diesem Tag an zog sich Pascal zurück und widmete sich überwiegend geistlichen Aufgaben.
Pascal arbeitete an einer Verteidigung des christlichen Glaubens und machte sich ungefähr von 1657 an Notizen dazu. Er konnte das Werk allerdings nicht mehr fertigstellen. Pascal war von Kindheit an schwächlich und konnte seit seinem 18. Lebensjahr keinen Tag ohne Schmerzen genießen. Am 19. August 1662 starb er jung im Alter von 39 Jahren. Die Fragmente seiner Arbeit erschienen nach seinem Tod als Les Pensées (dt. ‚die Gedanken’) und sind bis heute vielgelesene und geschätzte apologetische Texte.
Zur großen Freude der Pascal-Leser ist 2015 der erste Band einer vierbändigen Briefausgabe in deutscher Sprache erschienen. Der erste Band umfasst 22 Briefe und Brieffragmente aus den Jahren 1643–1660/61. Pascal nutzte Briefe als literarische Stilmittel, für den wissenschaftlichen Gedankenaustausch sowie die persönliche Korrespondenz.
Der erste Band der Reihe enthält private Briefe. Zunächst 9 an die Familie gerichtete Schreiben. Darunter ist auch sein wohl berühmtester Brief, ein Trostschreiben an die Familie Périer vom 17. Oktober 1651. Aus Anlass des Todes seines Vaters stellt Pascal darin „allgemeine Betrachtungen über Leben, Krankheit und Tod an, sofern sie aus christlicher Perspektive aus Gottes Hand genommen werden können“ (S. 25). Ein berückendes Schreiben zur Verherrlichung der Größe Gottes. Der Philosoph stellt der trostarmen Vorstellung, der Lauf der Dinge werde durch den Zufall bestimmt, ein Bekenntnis zur Allmacht Gottes gegenüber. Denn Gott hat von Ewigkeit her in seiner Vorsehung einen Ratschluss gefasst, „der in der Fülle der Zeiten ausgeführt werden soll, in einem gewissen Jahr, an einem gewissen Tag, zu einer gewissen Stunde, an einem gewissen Ort und auf eine gewisse Art …“ (S. 53). „Wir müssen“, so Pascal, „nämlich Trost für unsere Übel nicht in uns selbst suchen, auch nicht bei anderen Menschen oder bei allem, was erschaffen wurde, sondern bei Gott. Und der Grund ist, dass kein Geschöpf die erste Ursache der Geschehnisse ist, die wir Übel nennen, vielmehr ist die Vorsehung Gottes deren einzige und wahrhaftige Ursache, deren unumschränkter Herr und Gebieter, und darum gibt es keinen Zweifel, dass man unmittelbar zur Quelle zurückgehen und bis zum Ursprung hinaufsteigen muss, um wahrhaftige Erleichterung zu finden“ (S. 52).
Die zweite Gruppe (B) enthält nur einen besonderen Brief, nämlich das Schreiben, das Pascal 1652 an die Königin Kristina von Schweden gerichtet hat. Die Königin hatte von seinen Forschungen zur Rechenmaschine erfahren und ließ sich dazu über den Mediziner Pierre Bourdelot Erkundigungen einholen. Pascal schrieb daraufhin der Königin und trat dabei bescheiden und souverän zugleich auf. Betont lobt er die Königin für ihre Liebe zur Wissenschaft (vgl. S. 77). Der Brief ist – so sagt es der Pascal-Kenner Eduard Zwierlein in seiner Einleitung – „ein kleines Meisterwerk nicht nur der Gedankeninhalte, sondern auch der Subtilität der Botschaften, der Disposition und der stilistischen Formung im Spiel der Antithesen, Kontraste, Chiasmen und Verschränkungen“ (S. 25).
Die dritte Gruppe (C) gibt 9 Briefe wieder, die an Mademoiselle de Roannez gerichtet sind. Mademoiselle war wohl eine Zeit lang in Pascal verliebt, verspürte gleichwohl zu der Zeit, in der die Briefe entstanden, die Berufung, in das Kloster von Port Royal einzutreten. Port Royal südwestlich von Versailles war ein Frauenkloster des Zisterzienserordens und im 17. Jahrhundert ein Zentrum jansenistischen Ideenguts (es wurde auf Anordnung Ludwigs XIV. 1710 zerstört). Der Bruder von Mademoiselle de Roannez, ein Herzog, stand der Klosterberufung ablehnend gegenüber und versuchte, Pascal auf seine Seite zu ziehen. Der aber unterstütze die Dame auf ihrem geistlichen Weg. Die Briefe dieser Gruppe zeugen von der „emotionalen Intelligenz“ Pascals und geben allerlei Hinweise auf seine geistliche Lebenseinstellung. Anrührend ist seine Menschenzugewandheit. In einem Brief aus dem Jahre 1657 ermutigt er Mademoiselle de Roannez, die mit allerlei Widerständen zu kämpfen hatte, mit den Worten: „Aufrichtig gesagt, Gott ist sehr verlassen. Wie mir scheint, leben wir jetzt in einer Zeit, da ihm der Dienst, den man ihm leistet, höchst wohlgefällig ist“ (S. 100).
Die letzte Gruppe (D) enthält drei Briefe. Ein kurzes Schreiben aus dem Jahre 1660 ist an seinen Freund, den Juristen und Mathematiker Pierre de Fermat (1607–1665), gerichtet. Es bezeugt die fragile Gesundheit Pascals. War er doch so schwach, dass er nicht ohne Stock laufen konnte und an das Sitzen im Sattel nicht zu denken war (vgl. S. 105). Schon 1648 hatte er seiner Schwester Gilberte geklagt, dass ihm nur wenige Stunden bleiben, in denen er Muße zum Arbeiten hat und sich zugleich gesund fühlt (vgl. S. 35). Erkennbar wird fernerhin, dass er inzwischen die Geometrie vernachlässigt, um sich wichtigeren Studien zu widmen. Pascal arbeitete zu der Zeit bereits an einer Apologie des christlichen Glaubens und widmete sich hingebungsvoll der Armenfürsorge.
Ergänzt wird der erste Band dieser Reihe durch eine Kurzbiographie, 70 Seiten Anmerkungen und eine Auswahlbiographie. Die von Eduard Zwierlein erarbeiteten Anmerkungen sind für Pascal-Freunde eine echte Fundgrube. Der erfahrene Übersetzer Ulrich Kunzmann, der bereits Übersetzungen der „Gedanken“ und der philosophischen Schriften Pascals besorgte, hat den Text vorzüglich in die deutsche Sprache übertragen.
Sogar jemand, der die Pensées wiederholt gelesen hat, wird den Briefband nach der Lektüre überrascht und berührt zurücklegen.
– – –
Vor einigen Tagen erschien beim Deutschlandradio ein Betrag zur Buchausgabe (ab Minute 9.30): dlf_20160707_1610_9cd1a474.mp3.
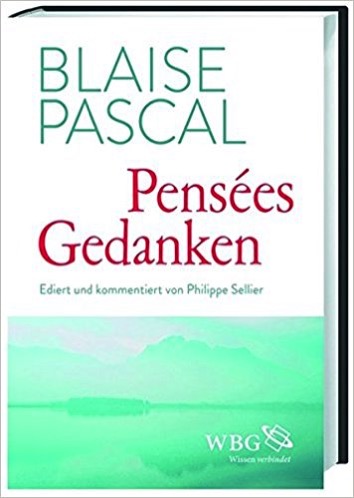 Nachfolgend ein Buchhinweis aus
Nachfolgend ein Buchhinweis aus  Der französische Mathematiker, Theologe und Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) gilt als Wunderknabe. Als Zwölfjähriger überraschte er seinen Vater, indem er auf dem Küchenboden selbständig die ersten 32 Lehrsätze der euklidischen Geometrie herleitete. Im Alter von 19 Jahren erfand er die erste mechanische Addiermaschine. Sieben Jahre später stellte er bereits den Pascalschen Satz auf, der besagt, dass in Flüssigkeiten der Druck gleichmäßig in alle Richtungen verteilt wird. Überdies gilt er heute als Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Der französische Mathematiker, Theologe und Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) gilt als Wunderknabe. Als Zwölfjähriger überraschte er seinen Vater, indem er auf dem Küchenboden selbständig die ersten 32 Lehrsätze der euklidischen Geometrie herleitete. Im Alter von 19 Jahren erfand er die erste mechanische Addiermaschine. Sieben Jahre später stellte er bereits den Pascalschen Satz auf, der besagt, dass in Flüssigkeiten der Druck gleichmäßig in alle Richtungen verteilt wird. Überdies gilt er heute als Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Blaise Pascal schrieb im Februar 1657 einen bewegenden Brief an Mademoiselle de Roannez, die wohl eine Zeit lang in den Philosophen verliebt war, sich aber dann für den Weg ins Kloster entschied (vielleicht, weil er ihre Liebe nicht erwiderte).
Blaise Pascal schrieb im Februar 1657 einen bewegenden Brief an Mademoiselle de Roannez, die wohl eine Zeit lang in den Philosophen verliebt war, sich aber dann für den Weg ins Kloster entschied (vielleicht, weil er ihre Liebe nicht erwiderte).