J.I. Packer: In seinen eigenen Worten
Vor rund 5 Jahren ist J.I. Packer heimgegangen. Eine Gelegenheit, noch einmal auf das zu hören, was ihm am Ende seines Lebens wichtig war:
Vor rund 5 Jahren ist J.I. Packer heimgegangen. Eine Gelegenheit, noch einmal auf das zu hören, was ihm am Ende seines Lebens wichtig war:
J.I. Packer schreibt über das mangelhafte Verständnis der Gnade Gottes innerhalb der Kirche (Gott erkennen, 2019, S. 153–154):
Es ist in allen christlichen Gemeinderichtungen üblich, den christlichen Glauben als eine „Religion“ der Gnade zu bezeichnen. Innerhalb der christlichen Lehre gilt es als ein festes Bekenntnis, dass die Gnade Gottes ein persönliches Handeln Gottes ist und keine mystische Kraft, nicht eine Art „himmlischer Elektrizität“, die man erhält, sobald man den „geistlichen Stecker“ an die Sakramente anschließt. Gottes Gnade bedeutet, dass Gott mit seinem Volk in Liebe handelt.
In verschiedenen Büchern und Predigten wird immer wieder hervorgehoben, dass das neutestamentliche griechische Wort für Gnade (charis), wie das Wort für Liebe (agape), einen christlichen Ursprung hat. Das Wort umschreibt eine unabhängige, selbstbestimmte Güte, und war in der griechisch-römischen Kultur und Theologie bis dahin völlig unbekannt. Es sollte zum Grundwissen eines jeden Christen gehören, dass die Gnade Gottes Reichtum auf Kosten des Opfers Jesu ist. Und doch scheint es so, als gäbe es nicht viele in unseren Gemeinden und Kirchen, die wirklich an Gottes Gnade glauben.
Aber es gab immer wieder einige, die den Gedanken an Gottes Gnade so überwältigend fanden, dass sie nicht anders konnten, als stets von dieser Gnade zu sprechen und Gott dafür zu loben. So sind einige der schönsten Loblieder entstanden – und es bedarf wirklich einer tiefen Begeisterung, um ein Loblied zu schreiben, das über Generationen hinweg in den Gemeinden gesungen wird. Sie haben für die Gnadenlehre Gottes gekämpft, ertrugen Spott und zahlten oft einen hohen Preis für ihre Einstellung. Da ist zum Beispiel Paulus, der diese Lehre gegen die Judaisten verteidigte, Augustinus, der sie vor Pelagius rechtfertigte oder die Reformatoren, die Gottes Gnade vor den Scholastikern verteidigten, und viele nach ihnen folgten ihrem Beispiel. Sie alle hielten sich an das Bekenntnis „Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin“ (1 Kor 15,10), und ihr Lebensmotto lautete: „Ich erkläre Gottes Gnade nicht für ungültig“ (Gal 2,21; eÜ).
Doch leider trifft dies auf die meisten Namenschristen nicht zu. Gottes Gnade ist bei ihnen bloß ein Lippenbekenntnis. Es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn wir sagen, dass sie gar keine Vorstellung von der Gnade Gottes haben. Der Gedanke daran bedeutet ihnen nichts und hat daher auch keinerlei Einfluss auf ihr Leben. Man kann mit ihnen über die Raumtemperatur des Gottesdienstraumes reden oder über die Bilanzen des letzten Jahres, doch kommt man auf die Wahrheiten zu sprechen, die der Begriff Gnade beinhaltet, stößt man auf Zurückhaltung und Verständnislosigkeit. Zwar würden sie niemals behaupten, dass unsere Worte sinnlos wären, und die meisten von ihnen würden auch nicht infrage stellen, dass sie irgendeine Bedeutung haben. Doch sie merken, dass das, was wir sagen, außerhalb ihres Erfahrungsschatzes liegt, und je länger sie ohne diese Erfahrung leben, umso sicherer sind sie, dass sie diese auch nicht nötig haben.
James I. Packer schreibt über die Menschwerdung Gottes (Gott erkennen, 3. Aufl., Leun: Herold 2019, S. 60–61):
Aber das eigentliche Problem, das alles überragende Geheimnis, mit dem uns das Evangelium konfrontiert, ist hier noch gar nicht angesprochen. Es findet sich nicht in der Karfreitagsbotschaft vom Sühnopfer, auch nicht in der Osterbotschaft von der Auferstehung, sondern in der Weihnachtsbotschaft von der Menschwerdung. Die atemberaubendste Botschaft des christlichen Glaubens ist, dass Gott in Jesus von Nazareth Mensch wurde. Die zweite Person der Gottheit wird zum „zweiten Adam“ (1Kor 15,47), der das menschliche Schicksal bestimmt und der Stellvertreter des Menschengeschlechts ist. Und Er wurde Mensch, ohne seine Göttlichkeit zu verlieren, so dass Jesus von Nazareth in seinem Menschsein wahrhaftiger und vollkommener Gott war.
Hier haben wir zwei Geheimnisse in einem – die Pluralität der göttlichen Personen innerhalb der Einheit Gottes und die Einheit der Gottheit und Menschheit in der Person von Jesus. Wir blicken bei dem, was zur ersten Weihnacht geschah, in das tiefgründigste und unergründlichste Geschehen der christlichen Offenbarung: „Das Wort wurde Fleisch“ (Joh 1,14). Gott wurde Mensch, der göttliche Sohn wurde ein jüdischer Junge. Der Allmächtige erschien auf der Erde als ein hilfloses menschliches Baby, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe lag, das gestillt und trockengelegt wurde, heranwuchs und sprechen lernen musste, wie jedes andere Kind. Und das war keine Vorspiegelung falscher Tatsachen: Der Säugling Jesus war tatsächlich Gottes Sohn. Je mehr wir darüber nachdenken, desto unbegreiflicher erscheint es uns. Keine Fiktion ist so fantastisch, wie diese Wahrheit der Inkarnation.
Dies ist der wirkliche Stein des Anstoßes des Christentums. Hier haben Juden, Muslime, Unitarier, Zeugen Jehovas und viele andere im Blick auf die Jungfrauengeburt, die Wunder, das Sühnopfer und die Auferstehung ihre Not. Durch Unglaube oder zumindest durch einen unzulänglichen Glauben in Bezug auf die Menschwerdung entstehen gewöhnlich Probleme an anderen Stellen der Evangeliumsberichte. Aber wenn die Inkarnation als Realität anerkannt wird, lösen sich diese anderen Schwierigkeiten auf.
Wäre Jesus bloß ein bemerkenswerter, gottesfürchtiger Mensch gewesen, dann wären die Schwierigkeiten, das zu glauben, was das Neue Testament uns über sein Leben und Werk berichtet, wirklich riesig. Doch wenn Jesus dieselbe Person wie das ewige Wort ist, der Schöpfungsmittler des Vaters, „durch den er auch die ganze Welt erschuf“ (Hebr 1,2), ist es kein Wunder, wenn neue Schöpfungstaten sein Kommen in diese Welt, sein Leben in ihr und sein Verlassen dieser Welt begleiten. So ist es nicht erstaunlich, dass Er, der Urheber des Lebens, von den Toten aufersteht. Wenn Er wahrhaftig Gott, der Sohn, war, ist es dagegen viel überraschender, dass erst Er sterben musste, bevor Er wieder auferstand.
„Welch ein unfassbares Geheimnis! Der Unsterbliche stirbt“, schreibt Wesley. Doch die Auferstehung des Unsterblichen ist mit diesem Geheimnis nicht gleichzusetzen. Und wenn der unsterbliche Sohn Gottes freiwillig den Tod auf sich nahm, ist es nicht verwunderlich, dass dieser Tod für ein verlorenes Menschengeschlecht Heilsbedeutung hat. Sobald wir erkennen, dass Jesus Gott ist, können uns diese Fragen unmöglich Probleme bereiten. Dann stellen wir fest, dass alles aus einem Guss ist und vollständig zusammenhängt. Die Inkarnation ist an sich ein unergründliches Geheimnis, aber dadurch bekommt alles andere, was das Neue Testament bezeugt, erst seinen Sinn.
J.I. Packer (Gott erkennen, 2005, S. 43):
Wenn wir uns klarmachen, daß Bilder und Abbilder Gottes unsere Gedanken beeinflussen, wird uns auch im weiteren klar, wohin das Verbot im zweiten Gebot zielt. Ebenso, wie es uns verbietet, irgendwelche Gottesbilder in Metall zu gießen, verbietet es uns auch, irgendwelche geistigen Abbilder zu erträumen. Uns ein Bild von Gott im Kopf zurechtzubauen, kann ein ebenso klarer Bruch des zweiten Gebots sein, als ob wir uns ein Bild handwerklich zurechtzimmerten. Wie oft hören wir solche Sachen: „Ich stelle mir Gott meist vor als den großen Architekten (oder den großen Mathematiker, oder den großen Künstler).“ — „Ich stelle mir Gott nicht als den Richter vor — lieber denke ich einfach an den Vater.“ Erfahrungsgemäß wissen wir, daß solche Äußerungen oft die Einleitung sind und daß dann im weiteren irgendeine Aussage der Bibel in Zweifel gezogen wird. Es muß deutlich und in allem Ernst gesagt werden, daß derjenige, der sich die Freiheit nimmt, über Gott „nach seiner Fasson“ zu denken, das zweite Gebot bricht.
J.I. Packer schreibt (Knowing God, 2005, S. 167):
Die moderne Angewohnheit in der christlichen Kirche ist es, das Thema „Zorn Gottes“ herunterzuspielen. Diejenigen, die noch an den Zorn Gottes glauben (nicht alle tun das), sagen wenig darüber; vielleicht denken sie auch nicht viel darüber nach.
In einer Zeit, die sich schamlos an die Götter der Gier, des Stolzes, des Sexes und der Selbstverwirklichung verkauft hat, murmelt die Kirche über Gottes Güte, sagt aber praktisch nichts über sein kommendes Gericht. Wie oft hast du im vergangenen Jahr eine Predigt über den Zorn Gottes gehört, oder, wenn Du Pastor bist, hast Du darüber gepredigt? Ich frage mich, wie lange es her ist, dass ein Christ im Radio oder Fernsehen oder in einer dieser halbspaltigen Predigten, die in einigen nationalen Tageszeitungen und Magazinen erscheinen, direkt über dieses Thema gesprochen hat (und wenn einer das getan hätte, wie lange würde es dauern, bis er wieder gebeten würde, darüber zu sprechen oder zu schreiben).
Tatsache ist, dass das Thema des göttlichen Zorns in der modernen Gesellschaft zu einem Tabu geworden ist, und die Christen haben dieses Tabu im Großen und Ganzen akzeptiert und sich darauf konditioniert, das Thema nicht anzusprechen.
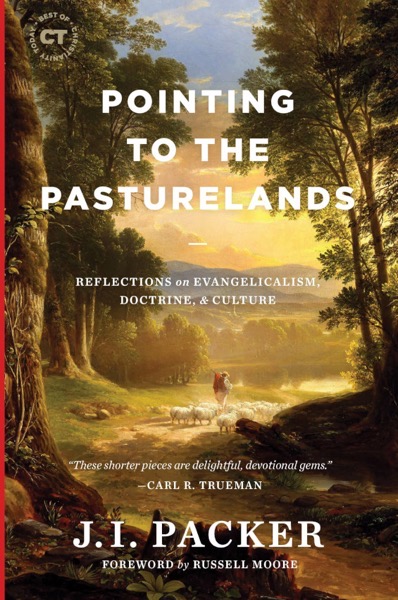 Daniel Vullriede stellt das Buch Pointing to the Pasturelands mit Artikeln, Aufsätzen und Leserbriefen des britisch-kanadischen Theologen James Innell Packer vor:
Daniel Vullriede stellt das Buch Pointing to the Pasturelands mit Artikeln, Aufsätzen und Leserbriefen des britisch-kanadischen Theologen James Innell Packer vor:
Einerseits zeigen Packers griffige Beiträge, wie essenziell es für Christen ist, in der Bibel gegründet zu sein und aus der Kirchengeschichte zu lernen. Die Gemeinde Jesu darf immer wieder zurückblicken und erkennen, was den Glauben und die Gläubigen ausmacht, um sich als Herde des einzig wahren, guten Hirten zu verstehen.
Andererseits geht er noch einen Schritt weiter. Fast in jedem seiner Texte lässt sich sehen, wie Packer die Kirche, die Welt und die Glaubensgeschwister herausfordert, ihre Augen für die wirklich saftigen Weiden zu öffnen. Er ermutigt sie, sich auf den Weg dahin zu machen – trotz oder gerade auch wegen der Herausforderungen der Gegenwart.
Dabei unterstreicht der Brite zwar, wie wichtig eine historisch-orthodoxe Theologie für die Gegenwart ist. Diese ist für Packer aber nie ein Selbstzweck. Auch kernige Kultur- und Kirchenkritik hat bei ihm ihren Platz, doch bleibt sie nicht in der reinen Polemik stecken. Vielmehr möchte Packer bewährte Alternativen zu liberaler Theologie, flacher Frömmigkeit oder einem rein pessimistischen Glauben präsentieren. Beispielhaft malt er den Lesern daher vor Augen, auf welch schöne, gute und richtige Art die christliche Lehre und das Leben in Christus im Hier und Heute zusammenpassen können.
Mehr: www.evangelium21.net.
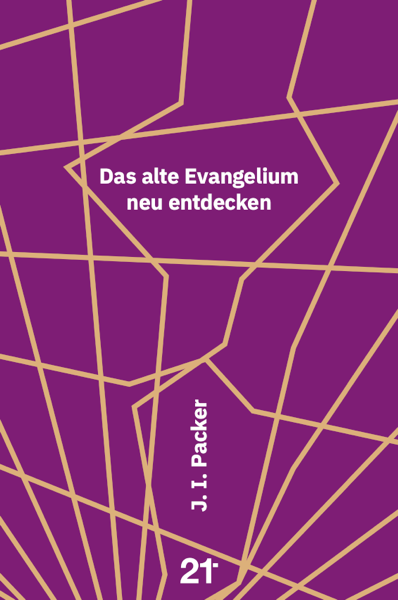 Das Booklet Das alte Evangelium neu entdecken enthält das Einführungsessay von Dr. J.I. Packer, das der Neuherausgabe des Originalwerks von John Owen, The Death of Death in the Death of Christ, vorangestellt war. Das Essay ist einer der meistgelesenen Texte Packers und hat – obwohl die Erstveröffentlichung schon über 60 Jahre zurückliegt – seine Aktualität nicht verloren. Es enthält eine pointierte Darstellung und Verteidigung des „alten“ Evangeliums und lässt sich unabhängig vom Werk Owens lesen. Packer beleuchtet sehr klar die Folgen für den Glauben und die Predigt, wenn das „alte“ durch ein anderes, „neues“ Evangelium ersetzt wird.
Das Booklet Das alte Evangelium neu entdecken enthält das Einführungsessay von Dr. J.I. Packer, das der Neuherausgabe des Originalwerks von John Owen, The Death of Death in the Death of Christ, vorangestellt war. Das Essay ist einer der meistgelesenen Texte Packers und hat – obwohl die Erstveröffentlichung schon über 60 Jahre zurückliegt – seine Aktualität nicht verloren. Es enthält eine pointierte Darstellung und Verteidigung des „alten“ Evangeliums und lässt sich unabhängig vom Werk Owens lesen. Packer beleuchtet sehr klar die Folgen für den Glauben und die Predigt, wenn das „alte“ durch ein anderes, „neues“ Evangelium ersetzt wird.
Das Booklet kann hier als PDF-Datei heruntergeladen oder als Druckversion bestellt werden: www.evangelium21.net.
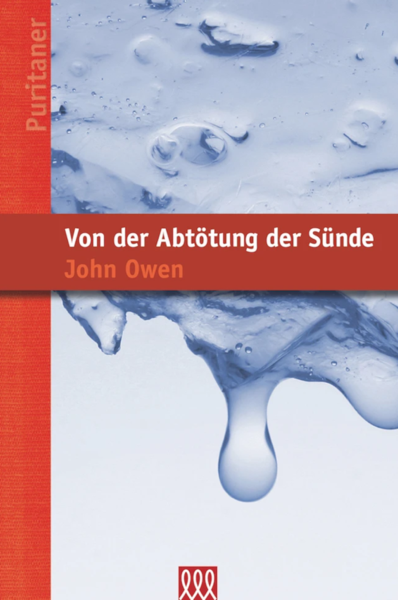 Sebastian Götz stellt ein bedeutendes Werk zur Sündenlehre vor, nämlich John Owens Buch Von der Abtötung der Sünde. Er schreibt:
Sebastian Götz stellt ein bedeutendes Werk zur Sündenlehre vor, nämlich John Owens Buch Von der Abtötung der Sünde. Er schreibt:
Wie werde ich die Sünde los? Jeder aufrichtige Christ wird sich diese Frage von Zeit zu Zeit stellen. Der eine geht mit eiserner Disziplin gegen einzelne Sünden vor und schafft es vielleicht, die eine oder andere Sünde unter dem Deckel zu halten. Falls es gelingt, steht aber oft schon die nächste Sünde vor der Tür, im Zweifel der Stolz über das Erreichte. Ein anderer gibt möglicherweise frustriert auf, weil er denkt, dass er keine Chance hat, siegreich zu sein. Er hofft, dass Gott ihm irgendwie gnädig sein wird. Trotzdem schlägt ihn die Sünde immer wieder zu Boden. J.I. Packer beschreibt im Vorwort des hier besprochenen Buches, welche „Kampfmethode“ er selbst als junger Christ kennengelernt hat. Er dachte, er müsse einfach alles loslassen und es dem Christus in ihm überlassen, zu kämpfen. Zu dieser Zeit wusste er allerdings noch nicht, dass ein bekannter Pastor, der diese Strategie lebte und lehrte, sich völlig verausgabt und einen vollständigen Nervenzusammenbruch erlebt hatte.
Gibt es noch einen anderen Weg, mit der Sünde umzugehen? Hilft nur eiserne Selbstdisziplin, Frustration oder das höhere, geistliche Leben? Der englische Puritaner John Owen beschreibt, wie Nachfolger von Jesus Christus Sünde Stück für Stück abtöten können. Sein Buch Von der Abtötung der Sünde ist eigentlich eine ausgearbeitete Zusammenstellung von seelsorgerlichen Predigten zu Römer 8,13. Dort steht: „Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben“. Die Predigten wurden ursprünglich in Oxford gehalten und erstmalig 1656 veröffentlicht. Obwohl das Buch nicht einfach zu lesen ist, wurde das Werk sehr bekannt. J.I. Packer, der die oben beschriebenen Verirrungen am eigenen Leib erfahren hat, bekennt sogar: Owen „half mir, mich als Christ selbst zu verstehen und vor Gott demütig und aufrichtig zu leben, ohne vorzutäuschen, entweder jemand zu sein der ich nicht bin, oder nicht zu sein, was ich bin“ (S. 16).
Mehr: www.evangelium21.net.
Das Buch kann beim 3L Verlag bestellt werden.
Benjamin Schmidt vom Herold Verlag stellt eines der wichtigsten christlichen Bücher aus dem 20. Jahrhundert vor: Gott erkennen von J.I. Packer. In seiner Besprechung schreibt er:
Packer weist in seinem Vorwort darauf hin, dass es ihm beim Verfassen des Buches Gott erkennen nicht darum ging, eine Abhandlung über Gott zu schreiben. Vielmehr wollte er „eine Reihe kleiner Studien über große Themen“ zu einem großen Thema über Gott und über unser Leben zusammenzufassen (S. 9). Die meisten Abschnitte des Buches waren ursprünglich für eine Artikelreihe des Evangelical Magazine erschienen und wurden für die Buchausgabe noch einmal stark erweitert.
Gott erkennen richtet sich an Menschen, die ein Gespür für den herrschenden Mangel an der Kenntnis über Gottes Wesen (sowohl in Kirche und Gesellschaft als auch im persönlichen Leben) haben, die sich aber mit der Flucht in den Skeptizismus nicht abfinden wollen. Ein großer Vorteil von Gott erkennen ist, dass es sich nicht an Theologen, sondern an gewöhnliche „aufrichtige Leser“ richtete, weshalb die Sprache bewusst einfach gehalten wurde. Dennoch sollte man schon eine gewisse Wertschätzung für – oder zumindest keine Abneigung gegen – handfeste Bekenntnisse haben, wenn man dieses Buch mit Gewinn lesen will. Wer sich aber darauf einlässt, der wird ermutigende und vor allem tragfeste Antworten finden.
Mehr: www.evangelium21.net.
J.I. Packer (Wie Gott vorzeiten geredet hat, 1988, S. 48):
Der gegenwärtige Zustand unserer Kirchen läßt kaum daran zweifeln, daß Gott begonnen hat, uns in diesen Tagen zu verlassen, als ein Gericht wegen unserer ehrfurchtslosen Mißachtung seines geschriebenen Wortes.
Was sollen wir tun? Mit unserer eigenen Kraft können wir den Heiligen Geist nicht zurückrufen und Gottes Werk unter uns neu beleben. Es ist Gottes alleiniges Vorrecht, uns wieder lebendig zu machen. Aber wir können zumindest die Hindernisse aus dem Weg räumen, über die wir gefallen sind. Wir können neu über die Lehren der Offenbarung und Inspiration nachdenken, wobei wir das Licht, das die moderne Forschung auf die menschlichen Aspekte der Schrift wie Kultur, Sprache, Geschichte und so fort geworfen hat, nicht verwerfen, aber den Skeptizismus bezüglich ihrer Göttlichkeit und ewigen Wahrheit ausscheiden.