Stott on the Christian Life
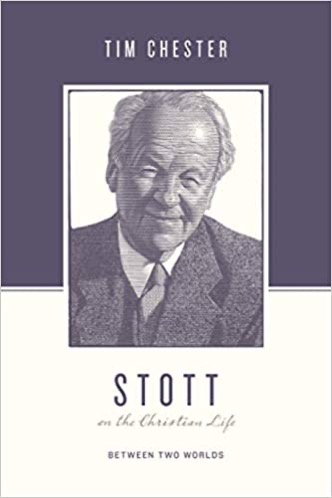 Heute vor 100 Jahren wurde John Stott, einer der großen Evangelikalen des 20. Jahrhunderts, geboren. Ein guter Tag, um das Buch Stott on the Christian Life von Tim Chester zu besprechen. Ich schreibe dort zum Thema „Selbstverleugnung versus Selbstliebe und Selbsthass“:
Heute vor 100 Jahren wurde John Stott, einer der großen Evangelikalen des 20. Jahrhunderts, geboren. Ein guter Tag, um das Buch Stott on the Christian Life von Tim Chester zu besprechen. Ich schreibe dort zum Thema „Selbstverleugnung versus Selbstliebe und Selbsthass“:
Nun hat Stott bemerkt, dass viele Menschen mit lähmenden Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen haben. Oft hängt das mit Erfahrungen in der Kindheit und Jugend und kulturellen Einflüssen zusammen. Die Botschaft der täglichen Selbstverleugnung (vgl. z.B. Lk 9,23) wird von solchen Christen bisweilen so aufgenommen, dass sie sich noch weniger zutrauen, als dies sowieso schon der Fall ist. Deshalb rief Stott weder zum Selbsthass noch zur Selbstliebe auf, sondern zur Selbstverleugnung und zur Selbstbejahung: „Er hebt sowohl die biblischen Appelle zur Selbstverleugnung hervor – insbesondere den Aufruf Jesu, uns selbst zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen (Mk 8,34) – als auch die Bejahung unseres Menschseins, die wir in der Lehre und Haltung Jesu erkennen“ (S. 107).
Wie ist dieser scheinbare Widerspruch zu verstehen? Stott löst die Spannung auf, indem er von einer zweifachen Identität des Christen spricht. „Diese doppelte Identität hilft uns zu erkennen, was Selbstverleugnung beinhaltet: ‚Das Selbst, das wir verleugnen, ablegen und kreuzigen sollen, ist unser gefallenes Selbst, alles in uns, was mit Jesus Christus unvereinbar ist“ (S. 107). Weil das so wichtig ist, zitiere ich das im Zusammenhang aus der deutschen Ausgabe von Das Kreuz. Zunächst schreibt er: „Was wir sind (unser Selbst oder unsere persönliche Identität) ist zum Teil das Resultat der Schöpfung als Ebenbild Gottes und zum Teil das Resultat des Sündenfalls als entstelltes Ebenbild. Das Selbst, das wir verleugnen, von dem wir uns lossagen und das wir kreuzigen sollen, ist unser gefallenes Selbst, alles in uns, was nicht mit Jesus Christus vereinbar ist (daher seine Aufforderungen ‚verleugne er sich selbst‘ und dann ‚folge mir nach‘). Das Selbst, das wir bejahen und wertschätzen sollen, ist unser erschaffenes Selbst, alles in uns, was mit Jesus Christus vereinbar ist (daher seine Aussage, dass wir uns selbst finden werden, wenn wir uns durch Selbstverleugnung verlieren). Wahre Selbstverleugnung, die Verleugnung unseres falschen, gefallenen Selbst, ist nicht der Weg zur Selbstzerstörung, sondern zur Selbstfindung.“
Mehr hier: www.evangelium21.net.