John Warwick Montgomery (1931–2024)
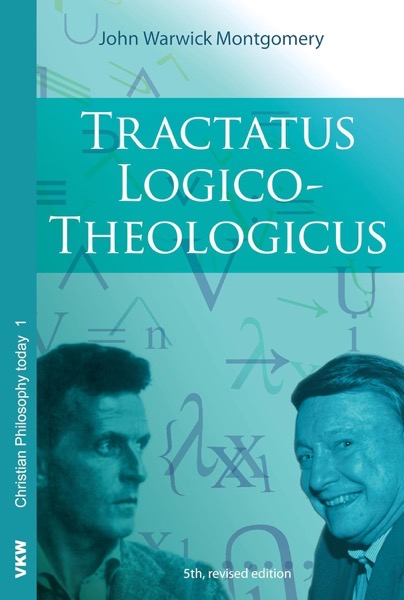 Am 25. September 2024 ist John Warwick Montgomery heimgegangen. Montgomery war nicht nur ein exzellenter Anwalt, er war vor allem ein scharfsinniger, lutherischer Apologet des christlichen Glaubens. Hohe Bekanntheit erlangte er innerhalb der christlichen Szene durch seine Konfrontationen mit Cornelius Van Til. Während Van Til als Pionier der tranzendentalen Apologetik gilt, machte sich Montgomery einen Namen als evidenzbasierte Apologet (vgl. hier).
Am 25. September 2024 ist John Warwick Montgomery heimgegangen. Montgomery war nicht nur ein exzellenter Anwalt, er war vor allem ein scharfsinniger, lutherischer Apologet des christlichen Glaubens. Hohe Bekanntheit erlangte er innerhalb der christlichen Szene durch seine Konfrontationen mit Cornelius Van Til. Während Van Til als Pionier der tranzendentalen Apologetik gilt, machte sich Montgomery einen Namen als evidenzbasierte Apologet (vgl. hier).
Vor etlichen Jahren habe ich Montgomery bei der Realisation einiger seiner Buchprojekte unterstützt, darunter der Tractatus logico-theologicus, Christ as Centre and Circumference und Christ Our Advocate [#ad]. In der Zusammenarbeit mit ihm konnte ich viel lernen, vor allem Akribi.
In Erinnerung an John Warwick Montgomery möchte ich nochmals veröffentlichen (vgl. hier), wie er sich an eine Vorlesung von Karl Barth erinnerte:
Barth in Chicago
Als ehemaliges Mitglied der theologischen Fakultät der Universität von Chicago besuchte ich vom 23. bis zum 27. April 1962 die Vorlesungen und Diskussionen von und mit Karl Barth. Ich hatte beträchtliche theologische Erwartungen, verließ die Veranstaltung jedoch auf sehr zwiespältige Weise bewegt.
Positiv betrachtet kann man Barth die stärkste, klarste Darstellung des Evangeliums zuschreiben, die es an der Universität von Chicago je gegeben hat. Ohne jegliche Entschuldigung oder anspruchsvolle Sinnverschleierung predigte Barth eine treffende, auf objektive Weise Christus in den Mittelpunkt stellende Botschaft von Gottes barmherziger Annahme des sündigen Menschen durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes.
Eine solche Botschaft hätte in keinem größerem Kontrast zu Chicagos theoogischer Fakultät stehen können, die ihrer „Divinity School“ schon in frühen Zeiten der Universitätsgeschichte durch ihre sozialgeschichtliche Interpretationsmethode des Christentums einen Namen gemacht hatte. Diese Methode wurde hauptsächlich von Shailer Mathews, Shirley Jackson Case, G.B. Smith, und J.M.P. Smith entwickelt und vertritt im wesentlichen die Meinung, dass
„Religion vor allem ein Phänomen des sozialen Erlebens eines bestimmten kulturellen Zeitalters“ ist, so die Bescheibung eines derzeitigen Mitgliedes des theologischen Fachbereiches, Bernard Meland. Barths Auffassung zufolge, die sich durch seine Kirchliche Dogmatik hindurch zieht, dürfe man das Christentum nie als „Religion“ in diesem Sinne bezeichnen, denn letztendlich ist es nicht das Produkt sozialer Erfahrungen des Menschen, sondern vielmehr das Ergebnis des offenbar gewordenen Wirkens des Wortes Gottes. Als Antwort auf eine Diskussionsfrage, gestellt von Schubert Ogden (ehemals tätig an der SMU und nun ebenfalls an der Universität von Chicago), entgegnete Barth:
Es ist stets eine meiner primären Absichten gewesen, die Eigenständigkeit der Theologie gegenüber der Philosophie und somit auch gegenüber dem zugehörigen Feld der Religion deutlich zu machen.
In einem theologischen Umfeld, das beständig von einer Verwirrtheit im Bezug auf besondere und allgemeine Offenbarungen geprägt ist, erschien Barth wie ein wiedererstandener George Fox, der ausruft „Wehe dir, elende Stadt Chicago“.
Doch unglücklicher Weise scheint die Wirkung der Verkündigung Baths durch seine andauernde Vernachlässigung angemessener erkenntnistheoretischer Theologie teilweise zunichte gemacht. Dieses Problem wurde von Jakob Petuchowski, einem Mitglied des „Hebrew Union College“, aufgegriffen, der in aller Aufrichtigkeit fragte, ob das Herantragen des christlichen Evangeliums an die Juden nicht das Einbeziehen eben jener textuellen und historischen Annahmen fordere, die Barth für gewöhnlich als irrelevant in Bezug auf die zentrale Verkündigung des Christus abwertet. Dieser Sachverhalt wurde umso schmerzhafter deutlich, als Edward John Carnell, ein neo-evangelikaler Vertreter, folgende Frage an Barth richtete: „Inwiefern bringt Dr. Barth seinen Standpunkt, dass die Schrift das objektive Wort Gottes ist, mit seiner Annahme, dass die Schrift mit Fehlern besudelt ist, theologisch, historisch oder sachlich in Einklang?“ Barth verbat sich zu Recht den Gebrauch des Ausdruckes „besudelt“ im Bezug auf seine Position, seine Antwort griff jedoch nicht den Kern der Frage auf, nämlich den Gegenstand angeblicher „theologischer Fehler“ in der Schrift. Dass Barth genau das frei heraus anerkennt, wurde in seiner Antwort auf eine andere Frage Carnells deutlich. Carnell stellte Barths Ablehnung, die ontologische Existenz des Teufels anzuerkennen, in Frage, und bezog sich in diesem Zusammenhang auf das bekannte Zitat Billy Sundays: „Aus zwei Gründen glaube ich daran, dass der Teufel existiert: Erstens, weil die Bibel es sagt, und zweitens, weil ich schon mit ihm zu tun hatte“. Barth konterte, dass die Einstellung Jesu und der Schreiber der Evangelien hinsichtlich der Existenz des Teufels nicht Grund genug sei, diese zu bejahen; eine Aussage die ihm Applaus von Seiten der Divinity School einbrachte.
Keine 20 Minuten später jedoch stellte Barth eine sehr detaillierte (und tadellose) Analyse der exakten Bedeutung des griechischen Ausdrucks „hypotassesthai“ in Römer 13,5 vor, und deutete an, dass dieser Abschnitt das „bewusste Mitwirken an gesellschaftlichen Ordnungen“ für den Christen zur Pflicht mache. Aber wieso sollte man sich bemühen, irgendein neutestamentliches Wort auf seine vollständige theologische Bedeutung hin auszulegen, wenn die eindeutige Position des Evangeliums zur Existenz des Satans schlichtweg abgetan werden kann? In gleicher Weise bot Barth in seinem abschließenden Vortrag über den Heiligen Geist keine Erörterung der Gegenwart des Geistes dar, sondern lediglich das vage Bild „menschlicher Freiheit“, denn „der Wind weht, wo er will“. Doch der Gebrauch der physischen Analogie erfordert die Fähigkeit, objektiv zwischen einer mit Kohlenstoffdioxid durchdrungenen Atmosphäre und einer, die mit Kohlenstoffmonoxid verunreinigt, ist zu unterscheiden.
Nicht-Christen auf der Suche nach Wahrheit, die sich im akademischen Publikum befanden, konnten nicht viel anders, als daraus zu schließen, dass es letztendlich Barths persönliche Vorliebe ist, die für ihn theologische Wahrheit ausmacht – und, dass sie somit jedes Recht dazu hatten, „seine“ Theologie lediglich als eine weitere Möglichkeit unter den zahlreichen existierenden Behauptungen unserer Zeit, von Alan Watts Zen hin zu Satres Existenzialismus, zu sehen.
Barths Vorträge in Chicago wiesen dieselben Stärken und Schwächen auf, die sich auch in seinem epochalen Kommentar zum Römerbrief von 1919 wiederfinden: starke Verkündigung, aber die Weigerung, die Quelle dieser Verkündigung erkenntnistheoretisch zu rechtfertigen. Aber in einer Zeit, in der ein Mangel an mutiger, kerygmatischer Verkündigung herrscht, sollte Barths Einsatz nicht abgewertet werden. Die Hymne Mozarts, die für die Eröffnungsfeier der Vortragsreihe ausgesucht worden war, hatte einen passenden Liedtext: „Laudate Dominum, Quoniam confirmata est supernos misericordia ejus, et veritas Domini manet in aeternum …“ [„Lobet den Herrn, denn seine Barmherzigkeit ist befestigt über uns und die Wahrheit des Herrn bleibt in Ewigkeit …“].
Prof. Dr. Dr. John Warwick Montgomery
Die Übersetzung und Wiedergabe des Beitrages erfolgte mit freundlicher Genehmigung des Autors. Übersetzt wurde der Text freundlicherweise von Daniela Stöckel. Der originale Beitrag stammt aus dem Buch: John Warwick Montgomery, The Suicide of Christian Theology, Newburgh, IN: Trinity Press, 7. Aufl. 1998, S. 191–193.
 John Warwick Montgomery gehört seid fünfzig Jahren zu den bedeutendsten christlichen Apologeten. Vor wenigen Tagen hat er einen umfangreichen Essayband publiziert (
John Warwick Montgomery gehört seid fünfzig Jahren zu den bedeutendsten christlichen Apologeten. Vor wenigen Tagen hat er einen umfangreichen Essayband publiziert (
 Viele halten John Warwick Montgomery für den führenden lebenden Apologeten biblischen Christentums. Der Universalgelehrte mit Gespür für die Kontroverse lebt in Frankreich, England und den Vereinigten Staaten. Seine internationalen Tätigkeiten haben ihn in persönlichen Kontakt mit einigen der aufregendsten Ereignisse unserer Zeit gebracht: er war nicht nur im Juni 1989 in China, er befand sich auch während der unblutigen Revolution von 1987 auf den Fidschi-Inseln, war daran beteiligt, Ostdeutschen während der Zeit der Berliner Mauer zur Flucht zur verhelfen und war während der »Maitage« 1968 in Paris. Dr. Montgomery ist Verfasser von rund 50 Büchern in fünf Sprachen. Er hat zehn Abschlüsse erworben, darunter einen Master der Philosophie in Jura von der Universität Essex in England, einen Ph. D. von der Universität Chicago, einen Doktortitel Protestantischer Theologie von der Universität Straßburg in Frankreich und das höhere Doktorat in Rechtswissenschaft (LL.D.) von der Universität Cardiff in Wales. Er ist ordinierter lutherischer Geistlicher, in England zugelassener Anwalt und hat die Zulassung als Anwalt vor dem Höchsten Gerichtshof der Vereinigten Staaten und die Zulassung bei der Anwaltskammer von Paris in Frankreich. Er erreichte Freisprüche für die drei Missionare in Athen, die wegen Proselytismus verurteilt waren, vor dem Griechischen Berufungsgericht in 1986 und gewann die wichtigen Verfahren betreffs Religionsfreiheit Larissis v. Griechenland und Bessarabische Orthodoxe Kirche v. Moldawien vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Viele halten John Warwick Montgomery für den führenden lebenden Apologeten biblischen Christentums. Der Universalgelehrte mit Gespür für die Kontroverse lebt in Frankreich, England und den Vereinigten Staaten. Seine internationalen Tätigkeiten haben ihn in persönlichen Kontakt mit einigen der aufregendsten Ereignisse unserer Zeit gebracht: er war nicht nur im Juni 1989 in China, er befand sich auch während der unblutigen Revolution von 1987 auf den Fidschi-Inseln, war daran beteiligt, Ostdeutschen während der Zeit der Berliner Mauer zur Flucht zur verhelfen und war während der »Maitage« 1968 in Paris. Dr. Montgomery ist Verfasser von rund 50 Büchern in fünf Sprachen. Er hat zehn Abschlüsse erworben, darunter einen Master der Philosophie in Jura von der Universität Essex in England, einen Ph. D. von der Universität Chicago, einen Doktortitel Protestantischer Theologie von der Universität Straßburg in Frankreich und das höhere Doktorat in Rechtswissenschaft (LL.D.) von der Universität Cardiff in Wales. Er ist ordinierter lutherischer Geistlicher, in England zugelassener Anwalt und hat die Zulassung als Anwalt vor dem Höchsten Gerichtshof der Vereinigten Staaten und die Zulassung bei der Anwaltskammer von Paris in Frankreich. Er erreichte Freisprüche für die drei Missionare in Athen, die wegen Proselytismus verurteilt waren, vor dem Griechischen Berufungsgericht in 1986 und gewann die wichtigen Verfahren betreffs Religionsfreiheit Larissis v. Griechenland und Bessarabische Orthodoxe Kirche v. Moldawien vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Vor 50 Jahren starb der Schriftsteller und Philosoph Albert Camus (1913–1960) bei einem Autounfall. Sein Werk ist aktueller denn je und liefert Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Der Rheinische Merkur
Vor 50 Jahren starb der Schriftsteller und Philosoph Albert Camus (1913–1960) bei einem Autounfall. Sein Werk ist aktueller denn je und liefert Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Der Rheinische Merkur 

 John Warwick Montgomery schreibt in seinem Buch: Weltgeschichte wohin? (Neuhausen-Stuttgart; Hänssler Verlag, S. 30):
John Warwick Montgomery schreibt in seinem Buch: Weltgeschichte wohin? (Neuhausen-Stuttgart; Hänssler Verlag, S. 30):