Nachfolgend eine Kurzbesprechung des Buches (aus GuDh 1/2014, S. 64–65):
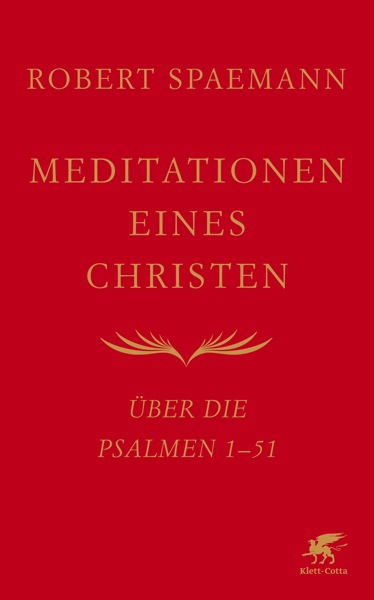 Der Band Meditationen eines Christen enthält besinnliche Auslegungen zu den ersten 51 Psalmen. Verfasst sind sie von Robert Spaemann. Spaemann, geboren 1927 in Berlin, zählt zu den wenigen christlichen Philosophen, die es in Deutschland noch gibt. Er besuchte, gemeinsam mit Odo Marquard, Günter Rohrmoser oder auch Ernst-Wolfgang Böckenförde Anfang der 50er-Jahre Seminare bei Joachim Ritter in Münster und promovierte unter ihm. Später habilitierte er sich in den Fächern Philosophie und Pädagogik und lehrte in Stuttgart, Heidelberg und seit 1972 in München Philosophie.
Der Band Meditationen eines Christen enthält besinnliche Auslegungen zu den ersten 51 Psalmen. Verfasst sind sie von Robert Spaemann. Spaemann, geboren 1927 in Berlin, zählt zu den wenigen christlichen Philosophen, die es in Deutschland noch gibt. Er besuchte, gemeinsam mit Odo Marquard, Günter Rohrmoser oder auch Ernst-Wolfgang Böckenförde Anfang der 50er-Jahre Seminare bei Joachim Ritter in Münster und promovierte unter ihm. Später habilitierte er sich in den Fächern Philosophie und Pädagogik und lehrte in Stuttgart, Heidelberg und seit 1972 in München Philosophie.
Der Katholik Spaemann ist Vertreter einer aristotelisch geprägten Naturphilosophie und verteidigt die Aktualität des Naturrechts. Freilich nicht in dem Sinn, dass die Natur eindeutige Normen lehrt, sondern die Natur uns die Möglichkeit gibt, unsere Handlungslegitimationen kritisch zu prüfen.
Spaemann glaubt gegen den postmodernen Zeitgeist an die universelle Vernunft. Anders als die Moderne, stellt er die Vernünftigkeit des christlichen Glaubens samt Offenbarungsanspruch in das Zentrum seiner Philosophie (vgl. R. Spaemann, Das unsterbliche Gerücht, 2007).
Begonnen hat Spaemann mit den Aufzeichnungen zu den Psalmen schon vor Jahrzehnten. Hans Urs von Balthasar (1905–1988), der wohl beste Karl Barth-Kenner unter den katholischen Theologen, bekam einige Text zu sehen und legte dem Autor eine Veröffentlichung nahe. Da Spaemann sie erst nach Beendigung seiner Lehrtätigkeit publizieren wollte, sind sie nun erschienen.
Spaemann spricht der historisch-kritischen Arbeitsweise durchaus einen Erkenntnisgewinn zu, konzentriert sich aber in diesem Buch auf die geistliche Aneignung der Texte. Der Schlüssel zum Verständnis der Psalmen ist für ihn „die Auslegung, die wir Jesus und den Aposteln verdanken. Sie setzt voraus, dass die Verfasser der Psalmen ‚vom Geist erleuchtet‘ wahren, dass es sich also um prophetische Texte handelte, die – oft ohne Wissen der Verfasser – auf eine messianische Zukunft verweisen“ (S. 9). Spaemann liefert eine „Innenansicht“. „Religion hat eine ‚fromme‘ Innenseite und eine psychologische, soziologische, kulturwissenschaftliche und phänomenologische Außenperspektive. Lebendig ist eine Religion nur kraft ihrer Innenseite. Wie es ist, verliebt zu sein, kann uns keine Psychologie oder Kultursoziologie nahebringen. Wir müssen es schon erfahren haben“ (S. 10–11).
So, wie ein evangelischer Christ wahrscheinlich die Lutherübersetzung für eine Psalmenauslegung wählt, greift Spaemann auf die Übersetzung von Joseph Franz von Allioli und die Vulgata zurück. Die Verszählung orientiert sich an der Einheitsübersetzung.
Das Buch hat mich die letzten Wochen begleitet. Als Leser spürt man, dass Spaemann die großen Menschheitsfragen durchdacht und vielleicht durchlitten hat. Obwohl seine Gedanken nicht dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit entsprechen wollen, sondern die eines anbetenden, offenbarungsgläubigen Laien sind, fehlt nirgends die Tiefgründigkeit. Die Sprache ist kraftvoll. Gelegentlich musste ich beim Lesen an Bonhoeffer denken. Ein ausführliches Beispiel. Zu: „Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Bösen und auf dem Weg der Sünder nicht steht und nichts sitzt, wo die Spötter sitzen“ (Ps 1,1), schreibt Spaemann (S. 14–15):
„Gottlosigkeit ist jene Grundorientierung, in welcher der Mensch entweder Gott leugnet oder lebt, als ob Gott nicht wäre. Der Gottlose rückt sich selbst als Individuum oder als Kollektiv in den Mittelpunkt, von wo aus er urteilt, was gut und schlecht, was schön und hässlich, was zu tun und zu lassen ist. Der Psalm spricht vom ‚Rat der Gottlosen‘, in dem der Unselige aus- und eingeht. Die Menschen mit der gottlosen Perspektive bilden einen ‚Rat‘, das heißt eine Verständigungsgemeinschaft. Zwar herrscht in dieser kein wirklicher Friede, denn wo Menschen sich selbst zum Mittelpunkt machen, wo sie einen babylonischen Turm bauen, da entsteht babylonische Verwirrung. Der Konflikt ist vorprogrammiert. Aber hinsichtlich der anthropozentrischen Perspektive sind sich die Gottlosen dennoch einig. Dass man keine ‚übernatürliche Hypothese‘ in die Beratung irdischer Dinge einführen dürfe, das bildet die gemeinsame Basis dieses ‚Rates‘. Wer den Weg der Seligkeit wählt, verkehrt nicht in diesem Rat, denn er kann sich mit jenen nicht verständigen, deren fundamentale Prämisse die Lüge ist.
Aus der Gottlosigkeit folgt die Sünde, das heißt das von Selbstsucht regierte Handeln, das bei aller Verschiedenheit in einem Punkt übereinstimmt: nicht mit der Ordnung Gottes übereinzustimmen. Die Sünder gehen einen ‚Weg‘. Dass der selige Mann ihn nicht geht, versteht sich von selbst. Aber so wie er im Rat der Gottlosen nicht beiläufig verkehrt, so ‚steht‘ er auch nicht am Weg der Sünder, das heißt, er hält sich gar nicht in diesem Umkreis auf, weil er nämlich gar nicht ‚steht‘, sondern selbst geht, aber einen anderen Weg.
Schließlich die Spötter. Sie sitzen. Sie sind Zuschauer – Zuschauer, die ihr Vergnügen daran haben, wenn das Gute ‚entlarvt‘ wird. Sie Hegen immer auf der Lauer, das Gute zu entlarven, weil sie seine Echtheit nämlich gar nicht wahrnehmen können. Sie lachen über die Tanzenden, weil sie die Musik nicht hören. Sie freuen sich, wenn der Gute der Dumme ist, denn für sie ist ein Leben aus göttlicher Perspektive ohnehin Dummheit.“
Das Buch wurde aufwendig gesetzt und gestaltet. Randglossen, wie die Psalmtexte farblich abgesetzt, bezeichnen die besprochenen Verse. Den stabilen Gewebeeinband schützt ein transparenter Schutzumschlag aus Kunststoff. Die aufwendige Gestaltung macht freilich das Buch auch teuer.
Der Leser, der sich an den hier und da zu findenden katholischen Bezügen nicht stört, wird das Buch genießen und durch die zahlreichen Gedankenanstöße und Querverweise bereichert, ermutigt und oft auch getröstet. Für mich war die Lektüre ein Gewinn.
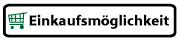

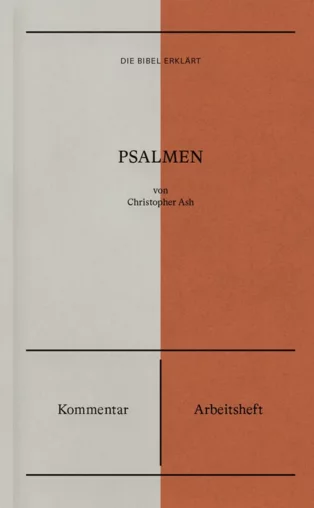

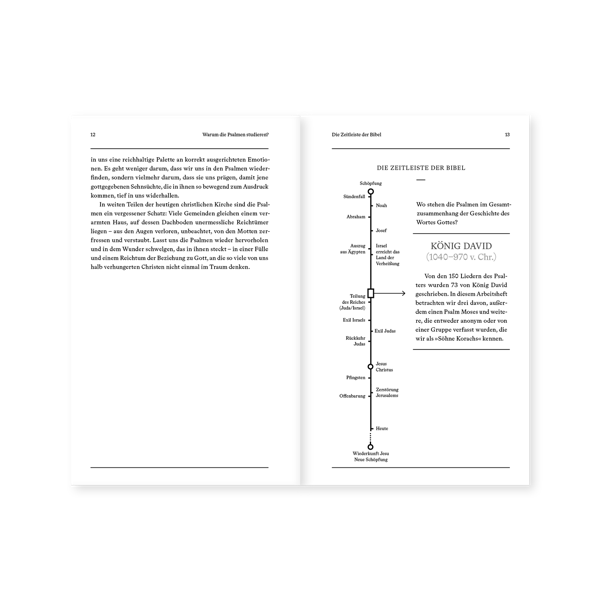
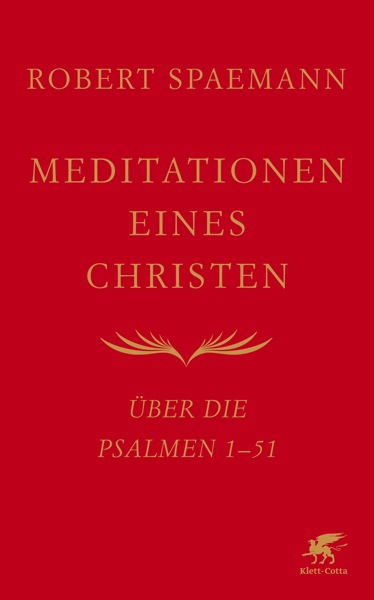 Der Band Meditationen eines Christen enthält besinnliche Auslegungen zu den ersten 51 Psalmen. Verfasst sind sie von Robert Spaemann. Spaemann, geboren 1927 in Berlin, zählt zu den wenigen christlichen Philosophen, die es in Deutschland noch gibt. Er besuchte, gemeinsam mit Odo Marquard, Günter Rohrmoser oder auch Ernst-Wolfgang Böckenförde Anfang der 50er-Jahre Seminare bei Joachim Ritter in Münster und promovierte unter ihm. Später habilitierte er sich in den Fächern Philosophie und Pädagogik und lehrte in Stuttgart, Heidelberg und seit 1972 in München Philosophie.
Der Band Meditationen eines Christen enthält besinnliche Auslegungen zu den ersten 51 Psalmen. Verfasst sind sie von Robert Spaemann. Spaemann, geboren 1927 in Berlin, zählt zu den wenigen christlichen Philosophen, die es in Deutschland noch gibt. Er besuchte, gemeinsam mit Odo Marquard, Günter Rohrmoser oder auch Ernst-Wolfgang Böckenförde Anfang der 50er-Jahre Seminare bei Joachim Ritter in Münster und promovierte unter ihm. Später habilitierte er sich in den Fächern Philosophie und Pädagogik und lehrte in Stuttgart, Heidelberg und seit 1972 in München Philosophie.