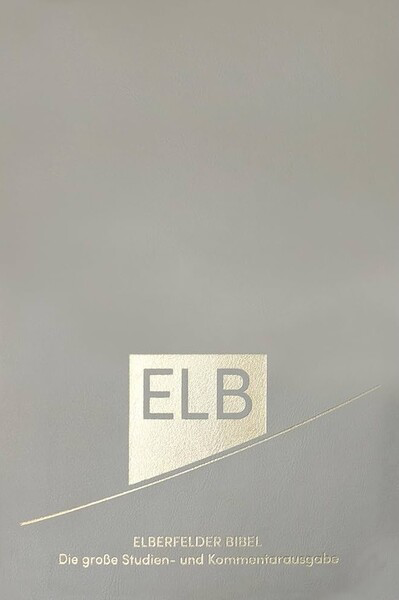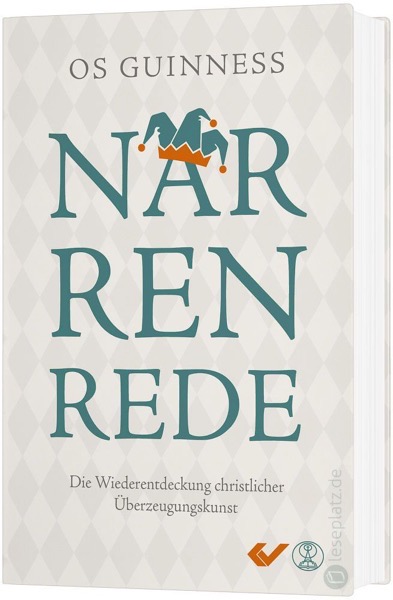Tim Kellers pastorale Integrität
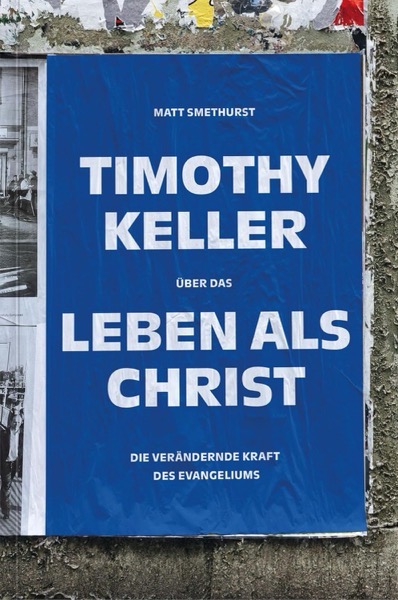
Philipp Bartholomä schreibt in seinem Vorwort zum Buch Timothy Keller über das Leben als Christ über die pastorale Integrität von Keller (Matt Smethhurst, Timothy Keller über das Leben als Christ, 2025, S. 7–14, hier S. 12–13):
„Die meisten Probleme sind die Folge einer mangelnden Ausrichtung am Evangelium. Fehlentwicklungen in der Gemeinde und sündige Strukturen in unserem Leben sind letztlich darauf zurückzuführen, dass wir die Auswirkungen des Evangeliums zu wenig durchdenken und das Evangelium nicht gründlich genug begreifen und annehmen. Oder positiv gesagt: Das Evangelium verändert unser Herz, unser Denken und unsere Haltung zu absolut allem. Wenn in einer Gemeinde das Evangelium in seiner Fülle ausgelegt und umgesetzt wird, dann wird hier eine einzigartige attraktive Verbindung von moralischer Haltung und Verständnis für andere entstehen.“ Kellers evangeliumszentrierte Theologie ist ein wichtiges Erbe, das wir dankbar und bleibend bewahren sollten. Denn nur durch eine konsequente Ausrichtung am Evangelium entstehen geistlich gesunde und missionarisch wirksame Gemeinden. Pastorale Integrität Schließlich kommt es nicht von ungefähr, dass Matt Smethurst seine Synthese der theologischen Grundüberzeugungen Tim Kellers mit einem Verweis auf dessen Integrität beendet. Keller „begehrte für sich keine großen Dinge“ (der 45,5), er machte nie viel Aufhebens um sich selbst. Seine beeindruckende Erfolgsgeschichte wurde nicht von diskreditierenden Skandalen geschmälert. Im Unterschied zu manch anderen Pastoren großer Megachurches baute Keller keine persönliche Plattform für sich. Er wollte auch nicht seine eigene Marke bewerben. Obwohl er die größeren kirchlichen Zusammenhänge strategisch im Blick hatte und sich in verschiedenen überregionalen Initiativen engagierte, verstand sich Keller immer zuerst als Pastor einer lokalen Kirche. Bis zu seinem 55. Lebensjahr machte er nur durch vereinzelte Publikationen auf sich aufmerksam. Den Großteil seiner Bücher veröffentlichte Keller erst nach Jahrzehnten treuer, pastoraler Arbeit, also auf dem glaubwürdigen Fundament eines sichtbaren track records. Alles, was Keller über das christliche Leben lehrte, wurde beständig und demütig im Alltag seines Gemeindedienstes auf Tauglichkeit geprüft. Seine gewachsene Social-Media-Reichweite nutzte er nicht für Selfie-durchtränkte Selbstdarstellung. Vielmehr wollte er seine Follower auf gute Inhalte hinweisen. Auch der vor Jahren vollzogene Nachfolgeprozess innerhalb der Redeemer Presbyterian Church und die damit verbundene Weitergabe von Verantwortung und Macht an die nächste Generation von Pastoren zeugt von Kellers uneigennützigem Charakter und davon, dass ihm das bleibende Wohl seiner Gemeinde wichtiger war als sein „eigenes Reich“. Aus der Ferne kann man das nur als vorbildlich betrachten. Sowohl Kellers enge Mitarbeiter, Freunde und Kollegen, die ihn gut kannten, als auch Mitglieder seiner Gemeinde bemerkten in den Tagen nach seinem Tod unisono, dass es keine Diskrepanz gab zwischen seiner Lehre, seinem öffentlichen Auftreten und dem Mann, den sie privat erlebten. Sie beschreiben Keller als demütig, aufrichtig und zugänglich. Freundlichkeit, Güte und Herzlichkeit zeichneten ihn aus. Er war weder distanziert noch unnahbar und trotz seiner internationalen Reputation – so bezeugten es viele – einfach „einer von uns“.