Einleitung
In einem Artikel vom 29. Dezember 2015 plädiert Tobias Faix für eine stärkere Betonung der weiblichen Seite Gottes in der christlichen Verkündigung. Er hat dabei auf verschiedene lexikalische Beobachtungen zurückgegriffen, die erörterungswürdig sind.
Ich möchte jedoch in der nachfolgenden, rasch ausgeführten, Untersuchung lediglich danach fragen, ob die zahlreichen in Anschlag gebrachten Bibeltexte die eingeforderte Rede vom „Mutterherz Gottes“ stützen. Ich zitiere dafür die angeführten Beweistexte, die in der feministischen Literatur immer wieder auftauchen, und ergänze sie durch kurze Vermerke.
Betrachtung der Bibeltexte
1. Gott als gebärende Frau
Dtn 32,18: „An den Fels, der dich gezeugt hat, dachtest du nicht mehr, und den Gott, der dich geboren hat, hast du vergessen.“
Der Vers spricht nicht von einer Frau, sondern davon, dass Gott (der Fels) uns gemacht hat. Das hebräische ḥyl kann gebären, aber auch zeugen, hervorbringen o. schaffen bedeuten. Da die Nomen „Gott“ und „Fels“ sowie das Verb „zeugen“ grammatisch maskulin sind, ist davon eher auszugehen.
Jes 42,4: „Lange bin ich still gewesen, habe ich geschwiegen, habe ich mich zurückgehalten, wie die Gebärende werde ich nun schreien, werde so sehr schnauben, dass ich um Luft ringen muss.“
Der Vers spricht nicht über eine Frau, sondern davon, dass Gott wie eine Gebärende schreien wird. Hier wird eine Tätigkeit Gottes beschrieben. Eine Eigenschaft oder Aktivität ist nicht mit Identität zu verwechseln. Zu sagen, dass mein Auto so schnell ist wie eine Rakete, bedeutet nicht, dass mein Auto eine Rakete ist.
Num 11,12: „Habe denn ich dieses ganze Volk empfangen, oder habe ich es gezeugt, dass du zu mir sagst: Trage es an deiner Brust, wie der Wärter den Säugling trägt, in das Land, das du seinen Vorfahren zugeschworen hast?“
Es handelt sich um einen Spruch des Mose. Er beschwert sich bei Gott, da dieser von ihm verlangt, sich um das Volk Gottes zu sorgen, so als sei es sein Kind. Es ist möglicherweise eine rhetorische Frage, die implizit mitteilt: „Du Gott hast das Volk gezeugt und aufgezogen“. Aber selbst dann, wenn das Bild feminin ist, ist der Text kein Beleg für die Weiblichkeit Gottes.
Hiob 38,8: „Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat [wie] aus dem Mutterschoß, …“
Die Erde wird als Mutterschoß beschrieben, aus dem das Meer hervorgekommen ist. Gott war derjenige, der das Wasser mit Toren zurückgehalten hat. Die GN übersetzt trefflich: „Wer hat das Meer mit Toren abgesperrt, als es hervorbrach aus dem Schoß der Erde?“.
Hiob 38,29: „Aus wessen Schoß ist das Eis gekommen, und wer hat den Reif des Himmels geboren?“
Der Vers erinnert tatsächlich an das Bild einer Mutter. Allerdings steht hier wie in V. 28 das Verb jld, welches, je nachdem, ob eine Frau oder ein Mann gemeint ist, mit gebären oder zeugen übersetzt wird. Da es hier maskulin ist, passt zeugen besser.
Joh 16,21: „Wenn eine Frau niederkommt, ist sie traurig, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie das Kind aber geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist.“
Hier wird die Verbildlichung einer gebärenden Mutter gebraucht, um die Zeit der Drangsal und Traurigkeit zu beschreiben, die auf die Jünger Jesu zukommt.
2. Gott als stillende Mutter
Num 11,11-12: „Und Mose sprach zum HERRN: Warum gehst du so übel um mit deinem Diener, und warum finde ich keine Gnade in deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volks auf mich legst? Habe denn ich dieses ganze Volk empfangen, oder habe ich es gezeugt, dass du zu mir sagst: Trage es an deiner Brust, wie der Wärter den Säugling trägt, in das Land, das du seinen Vorfahren zugeschworen hast?“
Der Text wurde unter Num 11,11 bereits kommentiert. Hier beschwert sich Mose bei Gott. Auch dann, wenn die Fragen rhetorisch gestellt sind, ist die feminine Illustration kein Beleg für die Weiblichkeit Gottes. Gott spricht maskulin (’mr).
Ps 131,2: „Fürwahr, ich habe meine Seele besänftigt und beruhigt; wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie das entwöhnte Kind ist meine Seele ruhig in mir.“
David beschreibt seine seelische Verfassung. Seine Seele ist wie ein entwöhntes Kind stille in ihm [also in David].
Jes 49,15: „Würde eine Frau ihren Säugling vergessen, ohne Erbarmen mit dem Kind ihres Leibs? Selbst wenn diese es vergessen würden, werde doch ich dich nicht vergessen!“
Ein Vergleich. Eine Mutter vergisst ihr Säugling nur ausgesprochen selten. Selbst wenn sie es vergisst, so ist Gott anders als eine Mutter. Er wird sein Volk nie vergessen.
Hos 11,4: „Mit menschlichen Seilen habe ich sie gezogen, mit Stricken der Liebe, und ich war für sie wie jene, die das Kleinkind an ihre Wangen heben, und ich neigte mich ihm zu, ich gab ihm zu essen.“
Das Bild bezieht sich auf Ephraim als Kuh (vgl. Hos 10,11). Gott hat das Arbeitstier schonend behandelt.
1Petr 2,2: „Verlangt jetzt wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie heranwachst zum Heil, …“
Petrus greift wie in 1Petr 1,23 das Bild vom Neugeborenen auf. Die wiedergeborenen Christen sehnen sich nach geistlicher Nahrung wie Säuglinge sich nach Muttermilch sehnen.
3. Gott, der einkleidet
Gen 3,21: „Und der HERR, Gott, machte dem Menschen und seiner Frau Röcke aus Fell und legte sie ihnen um.“
Dieser Text hat keinerlei Beweiskraft für die These des Artikels, es sei denn, es wird vorausgesetzt, dass ausschließlich Frauen in der Lage sind, Menschen einzukleiden.
Mt 6,25-34: „Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Schaut auf die Vögel des Himmels: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen — euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht mehr wert als sie? Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit auch nur eine Elle hinzuzufügen? Und was sorgt ihr euch um die Kleidung? …“
Wie bei Gen 3,21 hat auch dieser Text keine Beweiskraft. Hinzu kommt, dass in Mt 6 ausdrücklich vom „himmlischen Vater“ gesprochen wird (vgl. 6,26.32).
4. Gott erzieht
Jes 46,3-4: „Hört auf mich, Haus Jakob, und ihr, der ganze Rest des Hauses Israel, die ihr mir schon im Leib eurer Mutter aufgeladen worden seid und die ihr vom Mutterschoß an getragen worden seid: Bis in euer Alter bin ich es und bis ins hohe Alter: Ich bin es, der euch schleppt. Ich habe es getan, und ich werde tragen, und ich werde euch schleppen und euch retten.“
Gott trägt das Volk vom Zeitpunkt der Geburt an und wird es auch in Zukunft tragen und retten. Der Bezug zur These fehlt, es sei denn, es wird davon ausgegangen, dass nur eine Frau schleppen, tragen und retten kann.
Hos 11,1–4: „Als Israel jung war, habe ich es geliebt, und ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Sooft man sie rief, haben sie sich abgewandt von ihnen; den Baalen bringen sie Schlachtopfer dar und den Götterbildern Rauchopfer! Dabei war ich es, der Efraim das Gehen beigebracht hat – er hob sie auf seine Arme –, sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie geheilt habe. Mit menschlichen Seilen habe ich sie gezogen, mit Stricken der Liebe, und ich war für sie wie jene, die das Kleinkind an ihre Wangen heben, und ich neigte mich ihm zu, ich gab ihm zu essen.“
Siehe oben unter Punkt 2 (Hos 11,4).
5. Gott tröstet
Jes 66,13 „Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten, und getröstet werdet ihr in Jerusalem.“
Es handelt sich um einen einfachen Vergleich, nicht um eine behauptete Identität von Gott und Mutter. Vgl. die Anmerkung zu Jes 42,14 unter Punkt 1. Der Sprecher, Jahwe (v. 12), redet in der männlichen Form (’mr).
Offb 21,4: „Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein; denn was zuerst war, ist vergangen.“
Der Text hat keinerlei Beweiskraft im Blick auf die These, es sei denn, es wird verneint, dass ein Vater Trost spenden kann. Gen 5,29 spricht allerdings z.B. ausdrücklich davon, dass der Mann Noah trösten wird.
6. Gott als Geburtshelferin
Ps 22,10–11: „Du bist es, der mich aus dem Mutterschoß zog, der mich sicher barg an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an, von meiner Mutter Schoß an bist du mein Gott.“
Der Text hat keinerlei Beweiskraft, außer, es wird vorausgesetzt, dass ein Mann bei einer Geburt nie ein Helfer sein kann, so wie beispielsweise ein Gynäkologe die Geburt unterstützt.
Jes 66:
Hier gilt das Gleiche wie bei Ps 22,10-11.
7. Gott als Bärenmutter
Hos 13,8: „Ich falle über sie her wie eine Bärin, der man die Jungen genommen hat, und ich zerreiße die Brust über ihrem Herzen. Und dort fresse ich sie wie eine Löwin, die Tiere des Feldes reißen sie in Stücke.“
Hier wird Gott mit wilden Tieren verglichen, um den Ernst des göttlichen Gerichts herauszustreichen.
Ps 123,2: „Sieh, wie die Augen der Diener auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin, so blicken unsere Augen auf den HERRN, unseren Gott, bis er uns gnädig ist.“
Ein einfacher Vergleich ohne Beweiskraft im Blick auf die These. Es wird nicht gesagt, dass Gott eine Gebieterin ist.
Lk 15,8-10: „Oder welche Frau, die zehn Drachmen besitzt und eine davon verloren hat, zündet nicht ein Licht an, kehrt das Haus und sucht eifrig, bis sie sie findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So, sage ich euch, wird man sich freuen im Beisein der Engel Gottes über einen Sünder, der umkehrt.“
Erkenne keinen Zusammenhang mit der These.
8. Gott als Bäckerin
Mt 13,33: „Ein anderes Gleichnis nannte er ihnen: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mischte, bis alles durchsäuert war.“
Ein Gleichnis. Erkenne keinen Zusammenhang mit der These.
Lk 13,20-21: „Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist einem Sauerteig gleich, den eine Frau nahm und mit drei Scheffel Mehl vermengte, bis alles durchsäuert war.“
Ein Gleichnis. Erkenne keinen Zusammenhang mit der These.
9. Gott als Adlermutter
Ex 19,4: „Ihr habt selbst gesehen, was ich Ägypten getan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe.“
Ich bin kein Vogelkundler. Aber meines Wissens vertreibt oft die Adlermutter die Küken aus den Nestern und lässt sie fallen, damit sie fliegen lernen. Der Adlervater fängt sie dann mit seinen Flügeln auf. Aber selbst bei Arbeitsteilung spricht der Text nicht davon, dass Gott eine Adlermutter ist.
Dtn 32,11: „Wie ein Adler, der seine Brut aufstört zum Flug und über seinen Jungen schwebt, so breitete er seine Flügel aus, nahm es und trug es auf seinen Schwingen. Der HERR allein leitete es, kein fremder Gott war mit ihm.“
Ebenso wie Ex 19,4.
10. Gott als Henne
Ps 17,8: „Behüte mich wie den Augapfel, den Stern des Auges, birg mich im Schatten deiner Flügel“
Ps 57,2: „Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn bei dir suche ich Zuflucht. Im Schatten deiner Flügel suche ich Zuflucht, bis das Verderben vorüber ist.“
Figurative Rede, wie sie oft zu finden ist. Bei Gottes Flügeln findet man Zuflucht und Schutz, vgl. z.B. Ps 36,7; 57,1; 63,7-8.
Mt 23,37: „Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, und ihr habt nicht gewollt.“
Lk 13,34: „Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt.“
Auszug aus einer Strafrede Jesu. Das Bild von der Henne ist eindeutig figurativ zu verstehen.
Fazit
Der Artikel „Das Mutterherz Gottes“ wirft zahlreiche theologische Fragen auf. Um einige zu nennen: Ist im Hebräischen tatsächlich die Gebärmutter Ort der Gefühle und des Glaubens? Prägt die Biografie den Glauben eines Menschen prinzipiell stärker als die Theologie, determinieren also Vita und soziales Milieu die Bibelauslegung? Ist das zu Anfang geschilderte Beispiel nicht ein immens starker Hinweis darauf, dass wir unsere Erfahrungen gerade nicht auf Gott projizieren, sondern diese vielmehr von Gott her erleuchten lassen sollten? Ist das Shalom Gottes eine transformatorische Zusage Gottes für den Frieden in dieser Welt? Steht über das Wesen Gottes nur sehr wenig in der Heiligen Schrift? Warum finden wir in der Bibel keine Aufforderung, Gott als Mutter anzusprechen, die geforderte Anrede als Vater dagegen sehr wohl?
Diese kleine Untersuchung war freilich nicht den großen Fragen gewidmet. Es ging lediglich darum, ob die im Beitrag „Das Mutterherz Gottes“ aufgeführten 30 Bibeltexte die These stützen, dass die Heilige Schrift Gott mit zahlreichen weiblichen Bildern beschreibt (und „Mutterherz“ ein angemessener Begriff ist, um das Herz Jahwes zu bezeichnen). Viele der angeführten Begründungstexte haben im Blick auf die Behauptung keine Beweiskraft. Einige Texte rufen entsprechende Bilder oder Assoziationen hervor, ohne das sie ein weiblicheres Gottesbild erzwingen. Lediglich Hiob 38,29 könnte die Ansicht, Gott werde als gebärende Frau gekennzeichnet, stützen. Jedoch ist auch dieser Text nicht so evident, dass er den restlichen Befund kompensieren kann.
Ron Kubsch
– – –
Der Text kann hier auch als PDF-Datei heruntergeladen werden: MutterherzGottes1.1.pdf.
Nachtrag vom 31.12.15, 16.20 Uhr: Tobias hat die Ausführungen zu rǽḥæm für „Mutterschoß“ und lėb für Herz inzwischen korrigiert, so dass ein Hinweis darauf nur stört. Ich habe den entsprechenden Abschnitt deshalb gestrichen.
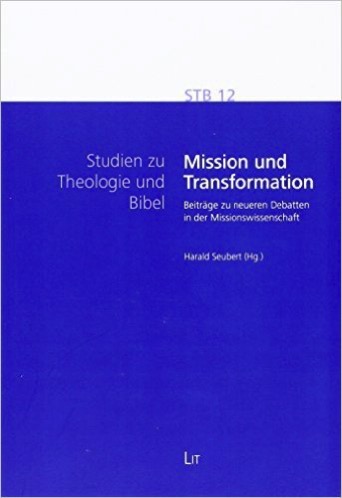 In den letzten Jahren hat die missionale Theologie weltweit für Aufsehen gesorgt. Ihre Vertreter leiten aus der Reich Gottes-Perspektive die kirchliche Verpflichtung ab, die Gesellschaft zu verändern, zum Beispiel, indem sie sich für den Umweltschutz oder „Soziale Gerechtigkeit“ einsetzen.
In den letzten Jahren hat die missionale Theologie weltweit für Aufsehen gesorgt. Ihre Vertreter leiten aus der Reich Gottes-Perspektive die kirchliche Verpflichtung ab, die Gesellschaft zu verändern, zum Beispiel, indem sie sich für den Umweltschutz oder „Soziale Gerechtigkeit“ einsetzen. Der französische Mathematiker, Theologe und Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) gilt als Wunderknabe. Als Zwölfjähriger überraschte er seinen Vater, indem er auf dem Küchenboden selbständig die ersten 32 Lehrsätze der euklidischen Geometrie herleitete. Im Alter von 19 Jahren erfand er die erste mechanische Addiermaschine. Sieben Jahre später stellte er bereits den Pascalschen Satz auf, der besagt, dass in Flüssigkeiten der Druck gleichmäßig in alle Richtungen verteilt wird. Überdies gilt er heute als Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Der französische Mathematiker, Theologe und Philosoph Blaise Pascal (1623–1662) gilt als Wunderknabe. Als Zwölfjähriger überraschte er seinen Vater, indem er auf dem Küchenboden selbständig die ersten 32 Lehrsätze der euklidischen Geometrie herleitete. Im Alter von 19 Jahren erfand er die erste mechanische Addiermaschine. Sieben Jahre später stellte er bereits den Pascalschen Satz auf, der besagt, dass in Flüssigkeiten der Druck gleichmäßig in alle Richtungen verteilt wird. Überdies gilt er heute als Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
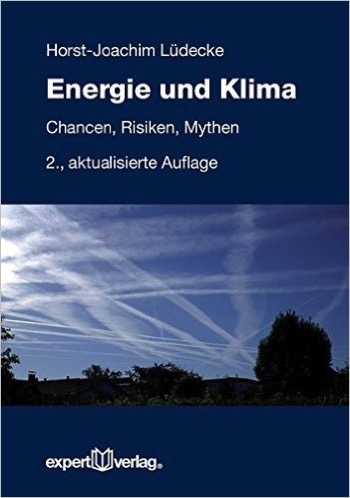 Da ich ein leidenschaftlicher Verteidiger der freien Wissenschaft bin, verweise ich heute auf eine Rezension von Holger Douglas zum Buch:
Da ich ein leidenschaftlicher Verteidiger der freien Wissenschaft bin, verweise ich heute auf eine Rezension von Holger Douglas zum Buch: Alvin Plantinga schreibt in seinem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von Warrent Christian Belief:
Alvin Plantinga schreibt in seinem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von Warrent Christian Belief: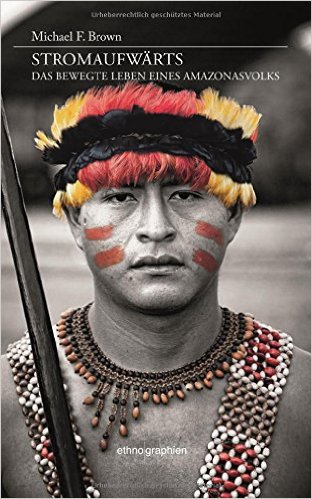
 Die großen Fragen des Lebens sind in den Augen vieler Menschen Fragen der Wirtschaft. Ökonomen erklären nicht nur, wie die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen entsteht und gedeckt werden kann oder warum es Arbeit, Kapital, Preise und Steuern gibt. Sie sagen auch manchmal Krisen voraus oder zetteln revolutionäre Umbrüche an. Große Wirtschaftsdenker wollen eben die Welt nicht nur deuten, sondern sie auch – wenigstens ein bisschen – verbessern.
Die großen Fragen des Lebens sind in den Augen vieler Menschen Fragen der Wirtschaft. Ökonomen erklären nicht nur, wie die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen entsteht und gedeckt werden kann oder warum es Arbeit, Kapital, Preise und Steuern gibt. Sie sagen auch manchmal Krisen voraus oder zetteln revolutionäre Umbrüche an. Große Wirtschaftsdenker wollen eben die Welt nicht nur deuten, sondern sie auch – wenigstens ein bisschen – verbessern.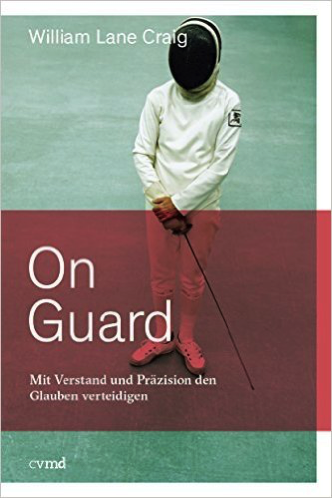 Mit Präzision den Glauben verteidigen
Mit Präzision den Glauben verteidigen Nachdem der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder bei seiner Vereidigung im Jahre 1998 auf das religiöse Bekenntnis „So wahr mit Gott helfe“ verzichtet hatte, begründete er seine Entscheidung mit dem Hinweis: „Religion ist Privatsache“ (das Beispiel wird in der Einleitung erwähnt, S. 11). Er nimmt damit, so sieht es jedenfalls zunächst aus, eine nachaufklärerische Position ein. „Religion scheint nur als ersetzbares Mittel zur Wahrung der persönlichen Psychohygiene, als esoterischer oder Überrest der Vormoderne, in jedem Fall als öffentlich nicht berücksichtigenswertes Phänomen betrachtet zu werden“ (S. 11). Allerdings haben die letzten Jahrzehnte gezeigt, dass die Religion sehr wohl eine öffentliche Rolle spielt. Etliche politische Auseinandersetzungen sind – zumindest teilweise – religiös aufgeladen. „Das Verhältnis von Religion und Öffentlichkeit ist keineswegs eines der Nicht-Berührung, sondern ein Feld voller explosiver Konflikte“ (S. 11).
Nachdem der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder bei seiner Vereidigung im Jahre 1998 auf das religiöse Bekenntnis „So wahr mit Gott helfe“ verzichtet hatte, begründete er seine Entscheidung mit dem Hinweis: „Religion ist Privatsache“ (das Beispiel wird in der Einleitung erwähnt, S. 11). Er nimmt damit, so sieht es jedenfalls zunächst aus, eine nachaufklärerische Position ein. „Religion scheint nur als ersetzbares Mittel zur Wahrung der persönlichen Psychohygiene, als esoterischer oder Überrest der Vormoderne, in jedem Fall als öffentlich nicht berücksichtigenswertes Phänomen betrachtet zu werden“ (S. 11). Allerdings haben die letzten Jahrzehnte gezeigt, dass die Religion sehr wohl eine öffentliche Rolle spielt. Etliche politische Auseinandersetzungen sind – zumindest teilweise – religiös aufgeladen. „Das Verhältnis von Religion und Öffentlichkeit ist keineswegs eines der Nicht-Berührung, sondern ein Feld voller explosiver Konflikte“ (S. 11).