Mit freundlicher Genehmigung veröffentliche ich nachfolgend gekürzt einen Beitrag von Michael C. Sherrard zum Thema „Sexuelle Orientierung und Weltanschauung“. Kurt Vetterli hat großzügigerweise seine Übersetzung zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Worum es bei dem Kampf um sexuelle Orientierung wirklich geht
Fällt es dir schwer zu verstehen, dass rational denkende Leute wirklich meinen, geschlechtsneutrale Toiletten seien eine gute Idee? Bist du verwirrt darüber, was in unserer Kultur passiert? Macht es irgendeinen Sinn für dich, dass Gesellschaften politischen oder wirtschaftlichen Druck anwenden, um unser Verständnis von sexueller Orientierung zu verändern? Es sieht folgendermaßen aus:
Beim Kampf um Sexualität oder geschlechtliche Orientierung geht es um eine Sache: ein bedeutungsvolles Leben. Das ist es, worum sich die ganze Streiterei dreht und warum der Kampf so hitzig geführt wird. Dieser Streit ist Teil eines größeren, übergeordneten Kampfes: Wie bekommt man ein bedeutungsvolles Leben? Und dazu musst du verstehen: die Antwort auf die vorhergehende Frage ist bestimmt durch deine Weltanschauung. Eine Weltanschauung ist eine Reihe von Glaubenssätzen oder Überzeugungen, die dich veranlassen, das Leben in einer bestimmten Weise zu sehen. Wir alle haben eine Weltanschauung, du kannst nicht ohne eine leben …
Ich habe eine christliche Weltanschauung. Ich habe Überzeugungen bezüglich der Realität. Unter anderem glaube ich, dass Gott existiert, dass die Welt rational ist (d.h. verstehbar) und dass das Leben eine objektive Bedeutung und einen ihm innewohnenden Wert hat. Meine Existenz ist die Quelle meiner Bedeutung und meines Wertes. Weil ich in Gottes Ebenbild gemacht bin, habe ich unschätzbare Würde.
Ich lebe jedoch in einer Gesellschaft, in der praktisch jedermann eine naturalistische Weltanschauung hat. Der Naturalismus enthält eine Reihe von Glaubenssätzen oder Überzeugungen über die Realität. Der Naturalismus hält unter anderem für wahr, dass Gott nicht existiert, dass die Welt nicht rational ist (obwohl sie nicht rechtfertigen können, dass dieser Glaube vernünftig ist), und dass das Leben keine innewohnende Bedeutung oder Wert hat. Und das ist eine schwerwiegende Sache. Hast du das mitbekommen? Das Leben hat keine eigentliche Bedeutung oder keinen Wert an sich. Was macht nun dein eigenes Leben für einen Sinn? Was hat es für einen Wert? Das ist das große Problem für den Naturalisten.
Seit langem haben Naturalisten die Konsequenzen und Probleme, die aus ihrer Weltanschauung resultieren, erkannt. George Orwell bemerkte dies in seinem Essay Notes on the Way. Darin schreibt er über die Notwendigkeit, die Seele ‚wegzuschneiden‘. Du musst sehen, dass gemäss dem Naturalismus das Selbst oder die Seele gar nicht existieren. Einfach ausgedrückt: Du existierst nicht. „Der Mensch ist nicht ein Individuum, er ist nur eine Zelle in einem immerwährenden Körper“, sagt Orwell. Das Problem jedoch ist, wenn du die Seele ‘wegschneidest’, dann findest du dich in einer sehr trostlosen Welt wieder: Existenz ohne jede Bedeutung oder Wert. Orwell hat das gesehen. „Für zweihundert Jahre hatten wir an dem Ast, auf dem wir sitzen gesägt und gesägt und gesägt. Und am Ende, viel schneller als jemand vorausgesehen hatte, wurden unsere Bemühungen belohnt und wir stürzten hinunter. Aber unglücklicherweise war da ein kleiner Fehler. Die Sache am Boden, auf die wir fielen, war nicht ein Bett aus Rosen, sondern eine Grube voller Stacheldraht.“
Nun, wie erlösen sich Naturalisten aus diesem Dilemma? Wie finden sie Bedeutung im Leben? Sie produzieren sie selbst. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre war ein Pionier darin, dem Naturalisten aus seiner Zwangslage zu helfen. Er stellte die These auf, dass Existenz der Essenz (dem Wesen) vorausgeht. Das heißt soviel wie dass du ein unbeschriebenes Blatt bist, so kannst du dein Leben zu dem machen, was immer du willst. Weil deine Existenz keine innewohnende (ursprüngliche) Bedeutung oder Wert hat, kannst du damit tun, was immer du willst. Sei ein Drache. Werde eine Frau. Heirate deine Mutter oder deinen Computer. Definiere dein Leben wie du es für passend hältst. Dein autonomer Wille ist es, das deiner Existenz Wert oder Bedeutung gibt. Er ist deine Würde.
Das ist es, worum es in dem Kampf geht. Damit wir eine bedeutungsvolle Existenz haben, müssen wir vollkommene Freiheit haben, uns selbst einzig nach unserem Willen zu formen. So ist eine Bedrohung der Freiheit, das eigene Geschlecht oder die eigene sexuelle Orientierung zu wählen, die Bedrohung einer ganzen Gesellschaft, die den Naturalismus als Weltanschauung angenommen hat und Bedeutung und Wert durch unbegrenzte Freiheit der Wahl anfertigen muss.
Lasst uns darüber im Klaren sein, was hier passiert! Unsere Gesellschaft agiert kollektiv aufgrund der Annahme, dass Gott nicht existiert und der Naturalismus wahr ist. Sie kämpfen darum, eine Gesellschaft zu formen, die diesen Glauben reflektiert. Das ist wiederum der Grund, warum der Kampf so intensiv ist. Es ist eine radikale Verschiebung in unserer Gesellschaft. Aber ich frage mich, ob die Leute sich wirklich bewusst sind, was hier passiert. Ich frage mich, ob wir bereit sind, dies in solch einer Weise zu deklarieren, dass Gott tot ist. Sind wir wirklich bereit, offiziell die Christliche Weltanschauung mit der naturalistischen zu ersetzen?
Ich meine Folgendes, und das mag dich schockieren: wir sollten bereit sein. Wir sollten die Christliche Weltanschauung verwerfen, wenn der Naturalismus wahr ist. Aber er ist es nicht. Der Naturalismus ist eine schwache Weltanschauung, wenn es darum geht, die Realität zu erklären. Und er bietet in Wirklichkeit keine rationale Rechtfertigung für seine Glaubwürdigkeit. Aber das ist Stoff für einen weiteren Artikel. Trotzdem denke ich, wir können nur einen Aspekt der Position des Naturalisten untersuchen und sehen, warum sie etwas ist, das wir nicht annehmen können.
Gemäß dem Naturalismus existiert Gott nicht. Darum, forme dein Wesen selbst, um deiner Existenz Bedeutung und Wert zu geben. Aber, weil Gott nicht existiert, kann auch das Selbst nicht existieren, das muss der Naturalist zugeben. Aber wenn das Selbst nicht existiert, kann auch kein freier Wille existieren. Gemäss dem Naturalismus bin ich eine “Zelle in einem immerwährenden Körper.” Ich bin bloss Moleküle in Bewegung. Chemie und Physik diktieren, wie ich agiere, fühle und auf diese Welt antworte. Ich bin nicht mehr als eine Maschine. Schlimmer, ich bin der Sklave meiner Natur. Freies moralisches Handeln ist ein riesiges Problem für den Naturalisten. Es wäre genau die Sache, die ich bräuchte, um eine bedeutungsvolle Existenz zu haben, aber es ist eben die Sache, die es nicht gibt, wenn der Naturalismus wahr ist.
Wie jemand ein Naturalist sein und gleichzeitig an einen freien Willen glauben kann, geht über mein Verstehen. Es ist die Spitze intellektueller Unehrlichkeit. Und deshalb kann ich nicht verstehen, wie jemand tatsächlich ein Naturalist sein kann. Die wichtigste Sache in seiner Weltanschauung ist gemäß eben dieser Weltanschauung nicht möglich. Das ist doch die höchste Form der Ironie …
Um es deutlich zu sagen, der Naturalismus ist die Weltanschauung, die uns diesen Kampf gebracht hat. Aus ihm folgt der Kampf, in dem wir uns gegenwärtig befinden. Weil Gott nicht existiert, hat das Leben keine Bedeutung außer der, die du selber herstellst durch deinen autonomen Willen. Ein bedeutungsvolles Leben ist das, was hier auf dem Spiel steht. Deshalb tobt der Kampf.
Was bedeutet dies also für uns? Zuallererst bedeutet es, dass wir uns um die Wurzel des Problems kümmern müssen. Wir können nicht nur Symptome diskutieren. Zu leicht werden wir in Argumente über Regeln über Toilettenbenutzung und was nicht alles gezogen. Das ist in Ordnung, wir sollten uns auch in solchen Konversationen engagieren. Aber unsere Bemühungen werden nicht fruchtbar sein, wenn wir nicht das Herz der Sache ansprechen. Die Forderung geschlechtsneutralen Toiletten entspringt aus der naturalistischen Weltanschauung. Also, bedenke, wie du dem Naturalismus begegnest.
Englisches Original: www.michaelcsherrard.com.
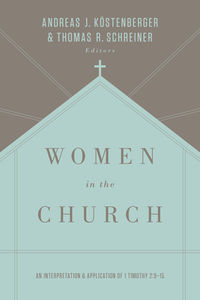
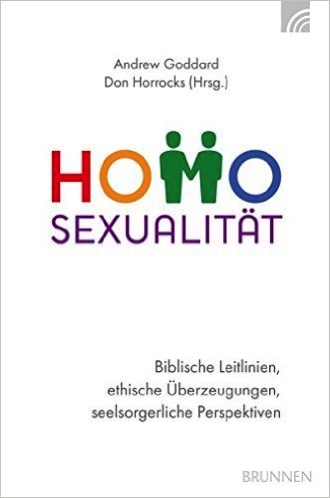 Die Rezension zum Buch:
Die Rezension zum Buch: