Vor fünf Jahren habe ich eine Renaissance des marxistischen Denkens angedeutet (Die Postmoderne, 2007, S. 61–62). Der Ökonom, Soziologe und Globalisierungskritiker Oliver Nachtwey schätzt in seinem am 18. Januar veröffentlichten Beitrag mit dem Titel „Geschichte ohne Parteibewusstsein“ die Lage ähnlich ein (FAZ vom 18.01.2012, Nr. 15, S. N3). Obwohl mit dem Fall der Mauer 1989 der gesellschaftliche Marxismus eine tiefe Demütigung hinnehmen musste, macht sich im elitären Raum der Universitäten seit Jahrzehnten ein von der marxistischen Philosophie inspiriertes Denken breit. Dass auch die Theologie der Hoffnung von Jürgen Moltmann, die mit ihrem eifrigen Drang auf Weltveränderung derzeit in den post-evangelikalen Kreisen entdeckt wird, „ohne die Richtungsstöße des Marxismus nicht denkbar“ ist, hat DER SPIEGEL bereits 1968 angemerkt (Nr. 4, 1968, S, 95).
Hier Auszüge des Artikels von Oliver Nachtwey mit einigen Zwischenbemerkungen [Hervorhebungen von mir]:
Der Marxismus schien nach 1989 endgültig bankrott. Doch auch die Bilanz des liberalen Kapitalismus rutschte schnell in die roten Zahlen, und die postmodernen, neoinstitutionalistischen und Rational-Choice-Theorien kamen in Erklärungsnöte. Börsenkurse sind für die poststruktualistischen Theoretiker nur ein Text in einer dezentrierten Welt, aber ihre Auswirkungen sind dann doch recht handfest.
Noch spürt der Otto Normalverbraucher nicht, dass die Aktienkurse keine rein selbstreferentiellen Zeichen sind. Durch die Aufnahme neuer Schulden lässt es sich vorübergehend so weiterleben, als wäre alles so wie es sein soll. Der Tag, an dem wir aufwachen, kann allerdings schneller kommen, als wir uns das wünschen. Spätestens nachfolgende Generationen werden mit den Tatsachen konfrontiert, dass wir unser Leben seit Jahrzehnten durch Kredite finanzieren.
Während in den kontinental- und südeuropäischen Ländern der Marxismus seinen Zenit erreicht hatte, kamen 1968 in den Vereinigten Staaten und Großbritannien erst mal viele junge, von Marx inspirierte Wissenschaftler an die Universitäten. Ironischerweise war es die liberale und wettbewerbliche Kultur der angelsächsischen Universitäten, die es dem Marxismus erlaubte, sich nachhaltig zu etablieren.
Warum „ironischerweise“? Ich würde – freilich etwas überspitzt – behaupten, dass es logischerweise die offenen Gesellschaften sind, die Andersdenkenden Entfaltungsräume zur Verfügung stellen. Die Geschichte des Marxismus ist eine Geschichte der geschlossenen Gesellschaften. Auch Rosa Luxemburgs „Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden“ hat leider daran nichts ändern können.
So entstand die Paradoxie, dass der akademische Marxismus nunmehr in jenen Ländern am stärksten ist, die sowohl in der Soziologie – das gilt für England – als auch im Marxismus Nachzügler waren und nie über starke kommunistische Bewegungen verfügt haben. Es entstand eine marxistisch orientierte Wirtschafts-, Geschichts-, Literatur- und Politikwissenschaft, Geographie, Soziologie, Kulturtheorie und Ethnographie, deren Forschungsprogramme auch von nichtmarxistischer Seite große Aufmerksamkeit erfuhren.
Der allgemeine Rückzug in die Nischen, die fatale Konzentration auf das Partielle und die Details – beispielsweise in der Philosophie –, hat der marxistischen Wirklichkeitsdeutung in zahlreichen Bereichen Auftrieb verschafft. Kurz: Wir denken heute marxistisch, ohne es zu ahnen.
Ein alles in allem überaus lesenswerter Beitrag, der m.W. online bisher nicht veröffentlicht wurde.
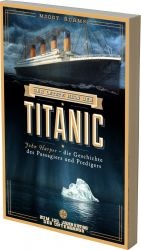 Passend zum „COSTA CONCORDIA“-Drama eine Empfehlung für das Buch:
Passend zum „COSTA CONCORDIA“-Drama eine Empfehlung für das Buch: