Abraham Kuyper: Der reformierte Denker
Denkerischer Ausgangspunkt für Kuyper ist das Bekenntnis zur absoluten Souveränität Gottes. Dieser Glaube an die allumfassende Königsherrschaft von Jesus Christus (engl. Lordship Principle) bedeutete ihm, dass der Calvinismus als eine Lebensanschauung (engl. Life-System) anzusehen ist, die jeden Bereich der Wirklichkeit berührt. Die Herrschaft von Jesus Christus über die gesamte Wirklichkeit konkretisiert sich in drei Ordnungen, die jeweils unmittelbar Gott unterstellt sind, nämlich Staat, Gesellschaft und Kirche (Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism, Grand Rapids, MI: Erdmans, Reprint 2002, S. 79).
Einerseits verteidigte Kuyper große (Wieder-)Entdeckungen der Reformatoren wie die tiefe Sündhaftigkeit aller Menschen, die Glaubensgerechtigkeit oder die Erwählung, andererseits gab er dem Calvinismus ein aufgeschlossenes und der Welt zugewandtes Gesicht. Gelingen konnte ihm das durch die gleichzeitige Betonung von Antithese und allgemeiner Gnade.
Mit der Antithese hebt Kuyper den Gegensatz von Kirche und Welt heraus. Die Kinder Gottes leben versöhnt nach dem Glauben zur Ehre Gottes. Die Kinder der Welt richten sich nach ihrem eigenen verdorbenen Herzen und rebellieren gegen Gott. Diese vorausgesetzte Antithese führt allerdings nicht in den Kulturpessimismus, dem Kuyper die „allgemeine Gnade“ gegenüberstellt.
Während die spezielle Gnade die erwählten Menschen erleuchtet und mit Gott versöhnt, schenkt uns die allgemeine Gnade, was wir zum Leben benötigen und begrenzt die sündhaften und destruktiven Mächte dieser gefallenen Welt. Von der allgemeinen Gnade profitieren also alle Menschen. Gott versprach im Noahbund, die Erde trotz der Bosheit der Menschen zu erhalten (vgl. Gen 8,21). „Solange die Erde währt, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“ Gen 8,22). Gott „lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte“ (Mt 5,45). Die allgemeine Gnade gibt den Ebenbildern Gottes das Mandat für die Erforschung und Gestaltung dieser Welt. Für die Christen heißt das, dass sie zusammen mit den Heiden kulturschaffend tätig sind. Sie arbeiten, sie engagieren sich für Gerechtigkeit und Wohlfahrt, sie sind künstlerisch tätig oder treiben Sport. All das verbindet sie nicht nur mit den Christen, sondern auch mit ihren ungläubigen Freunden und Nachbarn, deren Leistungen sie wertschätzen. Eine besondere Stellung räumte Kuyper übrigens der Wissenschaft ein, indem er sie in der Schöpfung ansiedelte. „Ohne Sünde“, schrieb Kuyper, „gäbe es weder einen Staat noch die christliche Kirche, aber die Wissenschaft“ (Wisdom & Wonder, Grand Rapids, Michigan, 2011, S. 35).
Im niederländischen Protestantismus erntete der Neo-Calvinismus mitunter scharfe Kritik. Kuyper wurde und wird vorgeworfen, er habe das reformierte Christentum von der überlieferten reformierten Theologie entfremdet. Tatsächlich veränderte sich unter ihm das „reformierte Selbstverständnis“.
Kuyper verlor beispielsweise vertraute Mitstreiter, als er eine Korrektur des Niederländischen Glaubensbekenntnisses (lat. Confessio Belgica) einforderte. Er störte sich am Artikel 36, wo zur Bestimmung des Staates gesagt wird, dass dieser nicht nur für die bürgerliche Verfassung zu sorgen hat, sondern auch darum bemüht sein soll, „dass der Gottesdienst erhalten werde, aller Götzendienst und falscher Gottesdienst entfernt werde, das Reich des Antichrists zerstört, Christi Reich aber ausgebreitet werde. Endlich ist es ihres Amtes zu bewirken, dass das heilige Wort des Evangeliums überall gepredigt werde und dass jeder Gott auf reine Weise nach Vorschrift seines Wortes frei verehren und anbeten könne“. Kuyper sah hier eine unzulässige Verknüpfung von Staat und Kirche und deshalb eine Verletzung der „Souveränität im eigenen Kreis“. Er war überzeugt, dass Familie, Staat und Kirche jeweils eigene Domänen sind, die sich gegenseitig nicht „hineinregieren“ sollten. R. S. de Bruïne (1869–1941) hat diese kuypersche „Sphärensouveränität“ einmal markant formuliert: „Es ist unsere Überzeugung, dass es nicht zur Berufung des Staates gehört, das soziale Leben von oben zu kontrollieren und es in vorgefertigte Bahnen zu pressen … Wir unterscheiden mehrere Kreise: den Staat, die Gesellschaft, die Kirche und die Familie, um nur einige zu nennen. Diese haben alle ihre eigene Natur, ihre eigene Autorität und Verantwortung. (zitiert nach: Joop M. Roebroek, The Imprisoned State, 1993, S. 55). Für Kuyper war es unerträglich, wenn der Staat kirchliche Aufgaben übernahm oder die Institution Kirche versuchte, Politik zu machen. Seine Bemühungen, die Korrektur des Artikels durchzusetzen, traf auf harten Widerstand (vgl. dazu: Peter Heslam, Creating a Christian Worldview: Abraham Kuyper‘s Lectures on Calvanism, 1998, S. 162–164). Schlussendlich wurde die Passage 1905 von den Reformierten Kirchen aber aus dem Bekenntnis gestrichen (Dirk van Keulen, „Der niederländische Neucalvinismus Abraham Kuypers“, S. 356).
Noch ein Beispiel: Vor Kuyper bestritten die Reformierten zwar nicht, dass Christen den Auftrag haben, Gesellschaft zu gestalten. Betont wurde aber vor allem die Erlösung von Sündern. Die Predigten befasste sich meist mit den großen biblischen Themen wie Buße, Glaube, Wiedergeburt, Rechtfertigung, Heiligung usw. Durch Kuyper verschob sich der Schwerpunkt hin zur Weltverantwortung. Die Frage, was der Heilige Geist in den Herzen der Sünder durch das Wort wirkt, wurde zwar nicht ausgeblendet, aber oft von dem überlagert, was Christen tun sollten, um Gesellschaft und Kultur zu prägen (vgl. Cornelius Pronk, „Neo-Calvinism“, S. 49).
Gern wird Kuyper deshalb heute für die sogenannte „transformative Kulturauffassung“ oder „Gesellschaftstransformation“ in Anspruch genommen. Demnach sind Christen dazu beauftragt, sich in gesellschaftliche Prozesse einzumischen und diese auf Mikro-, Meso- und Makroebene zu verändern. Ist diese Vereinnahmung von Kuyper berechtigt? Ja und nein. Tatsächlich wollte Kuyper den Protestantismus entprivatisieren und entwickelte eine „öffentliche Theologie“, die viele neue Anstöße für die parteiische Einmischung und Weltverantwortung lieferte.
Damit überwand er die von Immanuel Kant (1724–1804) angestoßene und noch heute gefragte Aufspaltung der Vernunft in einen öffentlichen und einen privaten Gebrauch. Es bedürfe der Freiheit, „von seiner eigenen Vernunft in allen Stücken öffentlich Gebrauch zu machen“, sagte Kant (Kant, „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“, 1974, S. 11). Er kontrastiert den öffentlichen Gebrauch der Vernunft mit dem privaten. Unter öffentlichem Gebrauch versteht er „denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht“ (Ibid., S. 9). Der Privatgebrauch der Vernunft könne dagegen eingeschränkt sein (Ibid., S. 11). Kuyper holte den Glauben, der sich auf Offenbarung berief, wieder
in den öffentlichen Diskurs zurück. Sein Ansatz hob dabei entschieden vom liberalen Kulturprotestantismus ab, der Evangelium und Kultur durchmischte. Zugleich unterschied er – wie oben bereits angesprochen –, scharf zwischen allgemeiner und rettender Gnade. Um es anders auszudrücken: Kuyper verwechselte die Erhaltungsethik nicht mit dem Aufbau von Gottes Reich. Darum wissend, dass das geistliche Reich nicht von dieser Welt ist (vgl. Joh 18,36), schrieb er (A. Kuyper, „Common Crace“ zitiert aus: David VanDrunen, Natural Law and The Two Kingdoms, 2010, S. 295):
Wir müssen zwischen zwei Dimensionen dieser Manifestation der Gnade unterscheiden. 1.a. eine rettende Gnade, die am Ende Sünde abschafft und ihre Folgen vollständig rückgängig macht; und 2. eine zeitliche zurückhaltende Gnade, die die Wirkung der Sünde abmildert und aufhält. Die erste … ist ihrer Natur nach eine besondere und auf die Auserwählten Gottes begrenzt. Die zweite … erstreckt sich auf das gesamte menschliche Leben.
Die Frucht der besonderen Gnade, die Menschen mit Gott durch Jesus Christus versöhnt, war eindeutig das Herzensanliegen von Kuyper (vgl. S.U. Zuidema, Common Grace und Christian Action in Abraham Kuyper, S. 6). Die Kirche als Institution sollte deshalb treu das Evangelium verkündigen. Kulturpräsenz wird erreicht, da die Kirche als Organismus in der Welt wohnt.
Kuypers Wirkung ist ambivalent. Er stärkte das nachmoderne Christentum auf dem Weg zu einem kulturpräsenten Christsein und inspirierte herausragene christliche Vordenker, unter ihnen Herman Bavinck (1854–1921), Hermann Dooyeweerd (1894–1977), Hans Rookmaaker (1922–1977) oder Francis Schaeffer (1912–1984). Doch auch Bewegungen wie der „Christian Reconstructionism“ von Rousas J. Rushdoony (1916–2001) und Greg L. Bahnsen (1948–1995) oder der „
shalom-Neo-Calvinismus“, wie er von Alvin Plantinga (* 1932) und Nicholas Wolterstorff (* 1932) vertreten wird, sind von Kuyper inspiriert. Interessanterweise ist der „Christian Reconstructionism“ anti-sozialistisch ausgerichtet und hebt die „Antithese“ zwischen christlichem und weltlichem Denken heraus (vgl. dazu: Thomas Schirrmacher, Anfang und Ende von Christian Reconstruction (1959–1995), 2001). Der „
shalom-Neo-Calvinismus“ ist demgegenüber sozialistischen Idealen aufgeschlossen und neigt dazu, die Immanenz Gottes und die Kontinuität zwischen der jetzigen und der zukünftigen Welt zu idealisieren (vgl. dazu: Williams Dennison, „Dutch Neo-Calvinism and the Roots for Transformation“, JETS 42 (1999), Nr. 2, S. 271–291). Gelegentlich wird von den „Transformisten“ deshalb eingestanden, dass sie sich mehr mit dem Beispiel als mit den inhaltlichen Anliegen des niederländischen Theologen identifizieren (z.B. Phillip Morgen, „Abraham Kuyper: Christ Transforming Culture, Helwys Society Forum, URL:
http://www.helwyssocietyforum.com).
Alles in allem leitete Kuyper vor ungefähr einhundert Jahren eine notwendige und begrüßenswerte Renaissance des reformierten Denkens ein. Wir dürfen dankbar sein, dass er die christliche Weltdeutung aus der Defensivhaltung herausführte und zahlreiche Christen ermutigte, den ideologischen Götzendienst des Modernismus zu dekonstruieren und christliches Denken einzuüben. Wer Jesus Christus nachfolgt, sieht die ganze Welt mit anderen Augen. Wir können und sollten viel von ihm lernen.
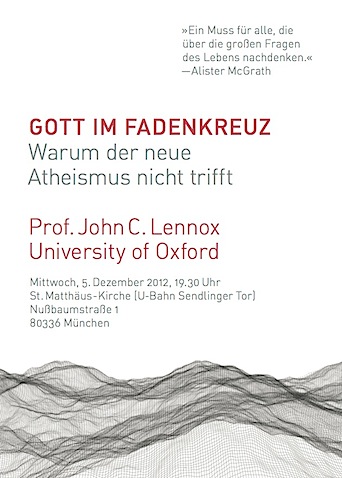
 Heute starte ich eine kleine Reihe über das Leben von Abraham Kuyper. Teil 1 der vierteiligen Reihe ist seiner Jugend und Ausbildung gewidmet.
Heute starte ich eine kleine Reihe über das Leben von Abraham Kuyper. Teil 1 der vierteiligen Reihe ist seiner Jugend und Ausbildung gewidmet.