Tim Challies hat kürzlich in seinem Blog eine wunderbare ihm zugetragene Episode aus dem Leben von Francis Schaeffer veröffentlicht. Sie passt so sehr zu Schaeffer, dass es mir eine Freude ist, sie hier anlässlich seines 100. Geburtsjahres wiederzugeben. Freundlicherweise gab Tim mir die Erlaubnis, die anrührende Geschichte hier in deutscher Sprache zu publizieren. Kathrin B. danke ich für die schnelle Übersetzung.
Hier also die Kurzgeschichte:
– – –
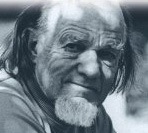 Doug Nichols ist einer meiner Internet-Freunde. Er ist der Gründer und Direktor von „Action International Ministries“, und in dieser Rolle reist er durch die ganze Welt und wirbt um Missionsarbeit und Evangelisation. Er mailt mir oft und aus aller Welt und schickt ermutigende Worte. Beinahe jeder elektronische Brief endet mit: „Lass mich Dich mit dem folgenden ermutigen“ und dann teilt er eine Bibelstelle mit mir. Ich liebe es.
Doug Nichols ist einer meiner Internet-Freunde. Er ist der Gründer und Direktor von „Action International Ministries“, und in dieser Rolle reist er durch die ganze Welt und wirbt um Missionsarbeit und Evangelisation. Er mailt mir oft und aus aller Welt und schickt ermutigende Worte. Beinahe jeder elektronische Brief endet mit: „Lass mich Dich mit dem folgenden ermutigen“ und dann teilt er eine Bibelstelle mit mir. Ich liebe es.
Es war schon lange her, im Sommer 1966, als Doug für „Operation Mobilization“ gearbeitet hat. Während ihrer großen Jahreskonferenz war er in London stationiert. Er war der Putzgruppe zugeteilt worden. Eines Nachts um 0.30 Uhr fegte er die Treppe im Konferenzzentrum, als ein älterer Herr zu ihm kam und ihn fragte, ob dies der Ort sei, an dem die Konferenz stattfände. Dough bejahte dies und erklärte, dass so gut wie jeder schon zu Bett gegangen sei. Dieser Mann war sehr einfach gekleidet und hatte nur eine kleine Tasche bei sich. Er sagte, dass er die Konferenz besuche. Doug antwortete, dass er versuchen würde, ihm einen Platz zum Schlafen zu finden und führte ihn zu einem Raum, in dem ungefähr 50 Menschen auf dem Boden schliefen. Der ältere Herr hatte nichts, worauf er schlafen konnte, also legte Doug eine Unterlage und eine Decke hin und bot ihm ein Handtuch als Kopfkissen an. Der Mann sagte, dass dies gerade gut genug sei und er es sehr schätzte.
Doug fragte den Mann, ob er die Möglichkeit gehabt hatte, zu Abend zu essen. Es stellte sich heraus, dass er nichts gegessen hatte, da er den ganzen Tag gereist war. Dough nahm ihn mit zum Speisezimmer, das allerdings abgeschlossen war. Nachdem er die Tür aufgebrochen hatte, fand er Cornflakes, Milch, Brot und Marmelade. Als der Mann aß, begannen sich die beiden zu unterhalten. Der Mann sagte, dass er und seine Frau viele Jahre in der Schweiz gearbeitet hätten, wo er einen kleinen Dienst hatte, der Hippies und Herumfahrenden half. Er sprach über seine Arbeit und über einige der Menschen, die sich zu Christus bekannten. Als er mit dem Essen fertig war, gingen beide Männer zum Schlafen.
Doug wachte am nächsten Morgen auf und stellte fest, dass er in großen Schwierigkeiten steckte. Die Konferenzleiter kamen zu ihm und sagten: „Weißt du nicht, wer es war, den du gestern Nacht auf den Boden gelegt hast? Es ist Francis Schaeffer! Er ist der Referent für diese Konferenz! Wir hatten einen ganzen Raum für ihn reserviert!“
Doug hatte keine Ahnung, dass er neben einer berühmten Persönlichkeit auf dem Boden übernachtet und er einen Mann gebeten hatte, auf dem Boden zu schlafen, der einen zutiefst wichtigen Dienst ausübte. Er hatte keine Ahnung, dass dieser Mann dabei geholfen hatte, die christliche Kirche der damaligen Zeit wie auch die Kirche unserer Tage zu prägen. Und Schaeffer hat sich nichts anmerken lassen. In Demut hat er sein „Schicksal“ angenommen und war dankbar dafür.
Dies ist nur ein kleiner Einblick in das Leben eines Mannes. Francis Schaeffer lebte 72 Jahre lang und diese kleine Episode verbrauchte weniger als die Hälfte eines der 26.000 Tage seines Lebens. Aber sie zeigt einem viel über diesen Mann. Ich denke, sie zeigt uns genauso viel von dem Mann, wie es sein öffentlicher Dienst tut. Ein Buch kann verkünden, dass er brillant ist, aber eine Geschichte wie diese zeigt, das er demütig ist. Eine Rede vor Tausenden von Menschen kann zeigen, dass er ein großer Denker ist, aber diese Geschichte zeigt uns, dass er gottesfürchtig und fromm ist. Es gibt so viel, was wir über einen Menschen von diesen ansonsten vergessenen Momenten lernen können. Es sind nicht nur die großen Dinge, die jemand tut, die eine Person ausmachen, sondern die kleinen.
Wenn Doug diese Geschichte erzählt, bietet er eine Anwendung an, die ihm geholfen hat. Nicht viele von uns haben den Intellekt eines Francis Schaeffer; nicht viele von uns werden jemals seine Fähigkeiten oder seine Weisheit haben. Aber was wir tun können, ist, uns nach anderen auszustrecken, um sie zu erreichen und ihnen mit gottesfürchtiger Demut zu dienen.
– – –
Wer mehr über das Leben und Werk von Francis Schaeffer lernen möchte, sollte sich diese Buch zum Einstieg besorgen:
-
Ron Kubsch (Hg.): Wahrheit und Liebe: was wir von Francis Schaeffer für die Gegenwart lernen können, Bonn: VKW, 2007



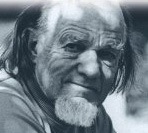 Doug Nichols ist einer meiner Internet-Freunde. Er ist der Gründer und Direktor von „Action International Ministries“, und in dieser Rolle reist er durch die ganze Welt und wirbt um Missionsarbeit und Evangelisation. Er mailt mir oft und aus aller Welt und schickt ermutigende Worte. Beinahe jeder elektronische Brief endet mit: „Lass mich Dich mit dem folgenden ermutigen“ und dann teilt er eine Bibelstelle mit mir. Ich liebe es.
Doug Nichols ist einer meiner Internet-Freunde. Er ist der Gründer und Direktor von „Action International Ministries“, und in dieser Rolle reist er durch die ganze Welt und wirbt um Missionsarbeit und Evangelisation. Er mailt mir oft und aus aller Welt und schickt ermutigende Worte. Beinahe jeder elektronische Brief endet mit: „Lass mich Dich mit dem folgenden ermutigen“ und dann teilt er eine Bibelstelle mit mir. Ich liebe es.