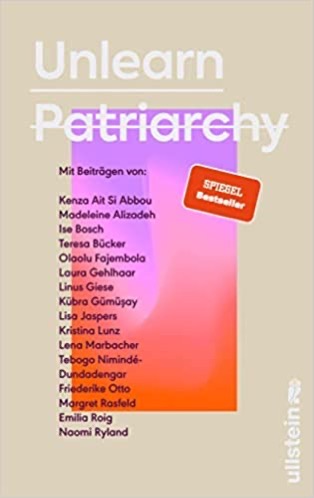 „Die Welt ist stark von patriarchalen Werten und Normen geprägt, und ich glaube, dass wir uns das sehr selten bewusst machen“, sagt Lisa Jaspers, Autorin und Mitherausgeberin des Sammelbands Unlearn Patriarchy (vgl. hier). Seit einigen Monaten wird viel über das Buch gesprochen. Die Klimaaktivistin Luisa-Marie Neubauer, die gefühlt in den deutschen Medien omnipräsent ist, schreibt darüber: „Große strukturelle Denkhindernisse werden in diesem Buch von klugen Köpfen analysiert. Sie helfen zu verlernen, was Gegenwart und Zukunft zerstört.“
„Die Welt ist stark von patriarchalen Werten und Normen geprägt, und ich glaube, dass wir uns das sehr selten bewusst machen“, sagt Lisa Jaspers, Autorin und Mitherausgeberin des Sammelbands Unlearn Patriarchy (vgl. hier). Seit einigen Monaten wird viel über das Buch gesprochen. Die Klimaaktivistin Luisa-Marie Neubauer, die gefühlt in den deutschen Medien omnipräsent ist, schreibt darüber: „Große strukturelle Denkhindernisse werden in diesem Buch von klugen Köpfen analysiert. Sie helfen zu verlernen, was Gegenwart und Zukunft zerstört.“
Was zerstört Gegenwart und Zukunft? Die Autorinnen des Buches eint die Überzeugung, dass patriarchale Verhaltensmuster und Glaubenssätze unser Leben prägen und daher aufgesprengt werden müssen. Dazu gehören beispielsweise Vernunft, Wahrheit und Wissenschaft, kurz: der Logos. Magnus Klaue schrieb treffend:
Denn für „Unlearn Patriarchy“ und alle Feinde des Westens, in deren Namen der Band spricht, sind Erziehung, Bildung, Sprache, Logos, Reflexions- und Urteilsfähigkeit nichts als Ausdruck des falschen Ganzen, das, weil alle wissen, dass damit immer das Schlechte gemeint ist, „Patriarchat“ heißt. Um dieses falsche Ganze zu bekämpfen, das sich in Form kollektiver schlechter Gewohnheiten niedergeschlagen hat, müsse man sich alle Spuren westlicher Sozialisation im Habitus, Denken und Sprechen abgewöhnen: Man muss buchstäblich den Glauben an Vernunft und Wahrheit verlernen, damit eine diverse Welt möglich ist.
Friederike Otto schreibt in ihrem Beitrag tatsächlich: „Wissenschaft ist daher das, was weiße Männer dafür halten, und das, was alle anderen von weißen Männern als wissenschaftlich zu erkennen gelernt haben“ (S. 95).
Doch Gegenwart und Zukunft wird nicht nur vom Logos, sondern auch von der bürgerlichen Familie und ihrer Heterosexualität zerstört. Emilia Roig treibt dieses Narrativ sendungsbewusst in ihrem Buchbeitrag „Unlearn Liebe“ voran (S. 60–61):
Die überwältigende Mehrheit der Menschen lebt in heterosexuellen Ehen oder Partnerschaften. Dies mag sich für viele Menschen natürlich anfühlen, aber die Heterosexualität ist größtenteils erlernt und wird gesellschaftlich gefördert und begünstigt. Warum? Weil sie wichtige Funktionen in unserer Gesellschaft erfüllt.
Die Frauen und ihre Sexualität, ihre Körper und Reproduktionsfunktion sowie ihre Arbeitskraft, ihren Besitz und ihr Kapital zu kontrollieren, ist die wichtigste Funktion der Heterosexualität – die durch die Ehe institutionalisiert wird. Diese Kontrolle kann nur kollektiv, institutionell, systemisch ausgeübt werden, auch wenn Frauen individuell das Gefühl haben, dass sie dieser Logik entkommen können und gar nicht in ihr gefangen seien. Unsere Sozialisation kultiviert in uns das Gefühl, dass die von uns erfahrene Liebe losgelöst sei von jeglichen gesellschaftlichen Mustern, von Hierarchien, Dominanz oder Unterdrückung. »Das mag alles draußen passieren, aber nicht bei mir, mein Mann ist anders. Uns betrifft das nicht.« Solche Sätze höre ich oft, wenn ich mich mit heterosexuellen Frauen über das Patriarchat unterhalte. Doch was in unseren intimen Leben geschieht, ist politisch und strukturell, nicht nur individuell -Frauen werden in eine Falle gelockt, wenn sie glauben, sie blieben verschont vom Patriarchat. So entwickelt sich ein Tabu: Das Patriarchat wird innerhalb der heterosexuellen Paarbeziehung nicht gern angesprochen. Feminismus ja, aber nur, wenn es die öffentliche Sphäre betrifft: Gender Pay Gap, sexuelle Belästigung auf der Straße, mangelnde Repräsentation der Frauen in Politik und Wirtschaft. Aber was zu Hause passiert, ist zu empfindlich, zu privat, zu fragil. Der Affekt ist zu groß. Patriarchale Muster innerhalb von heterosexuellen Beziehungen werden zudem oft individualisiert und nicht als systemisch betrachtet. Es handelt sich dann um »Beziehungsprobleme«, nicht um patriarchale Unterdrückung.
Da kommt die Liebe ins Spiel. Für Shulamith Firestone erfüllt die Liebe eine Schlüsselfunktion im Patriarchat. Sie könne mit einer Droge verglichen werden, die Frauen von der patriarchalen Unterdrückung abhängig mache.
Hier haben wir die klassische marxistische Sichtweise von der kleinbürgerlichen Familie, die die Unterdrückung des Menschen durch den Menschen aufrechterhält und daher beseitigt werden muss, um den Menschen zu befreien.
Carl Trueman schreibt dazu: „Die sexuelle Revolution hat letztlich ein großes Ziel, nämlich die Zerstörung der Familie. Das leuchtet ein, denn die Familie ist das wichtigste Instrument, mit dem Werte von einer Generation zur nächsten tradiert werden. Aus marxistischer Sicht ist die Familie somit das Mittel, mit dem das falsche Bewusstsein weitergegeben und im Laufe der Zeit reproduziert wird. Ihre Zerschlagung ist daher unerlässlich. Die Werkzeuge für diese Zerstörung finden sich für Firestone in den Mitteln der Technik“ (Der Siegeszug des modernen Selbst, 2022, S. 311).
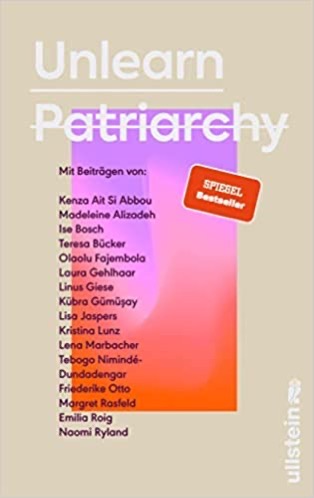 „Die Welt ist stark von patriarchalen Werten und Normen geprägt, und ich glaube, dass wir uns das sehr selten bewusst machen“, sagt Lisa Jaspers, Autorin und Mitherausgeberin des Sammelbands
„Die Welt ist stark von patriarchalen Werten und Normen geprägt, und ich glaube, dass wir uns das sehr selten bewusst machen“, sagt Lisa Jaspers, Autorin und Mitherausgeberin des Sammelbands