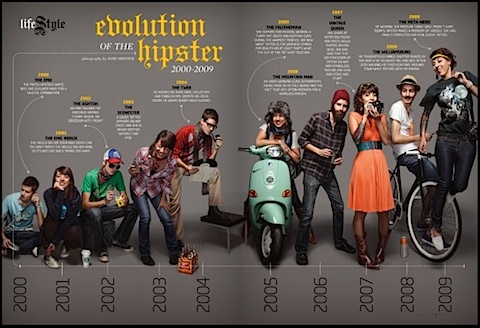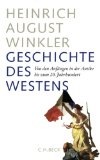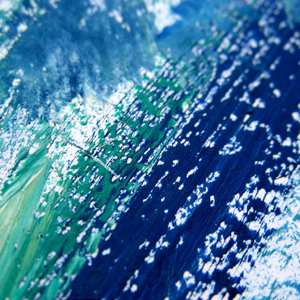Andreas Boppart, Missionsleiter von Campus für Christus in der Schweiz, hat in einem aktuellen idea-Kommentar dafür Partei ergriffen, in der Verkündigung einem Trend zu folgen, den die postmoderne Gesellschaft vorgebe. Viele junge Menschen empfänden Scham und sehnten sich danach, angenommen zu sein. Die Kirche erreiche solche Leute nicht mehr, wenn sie in der Verkündigung eine Schuldorientierung voraussetze. Unsere Kultur sei – so wie die griechische Kultur zur Zeit des Paulus (wirklich?) – eher schamorientiert. Die „Kreuzreduktion“ mit ihrer Schulddynamik müsse sich von daher zurücknehmen und einer Verkündigung Raum geben, die die Sehnsüchte der Menschen in einer Schamgesellschaft ernst nehme und durch eine angepasste Verkündigung sowie Gemeinschafts- und Gruppenzugehörigkeitserfahrungen auffange.
Zitat:
Wir mümmeln seit Jahren nun in irgendwelchen ethischen und moralischen Ecken und versuchen, die Schrauben zwischen falsch und „fälscher“ zu drehen. Die Fragen gehen immer in die Richtung: „Was heißt das jetzt für die sexuelle Moral?“ etc. Natürlich sind diese Fragen nicht unwesentlich – aber die Fragen, die wir uns als Kirche übergeordnet einmal stellen müssten, wären: „Was heißt das jetzt für das Evangelium? Was heißt das für unseren Auftrag als Kirche? Was heißt das für Christus-Nachfolge?“ Menschen, die sich nicht schuldig fühlen, brauchen keinen Christus, der am Kreuz für ihre Schuld stirbt. Alle Erklärungsversuche sind ebenso erfolglos, wie wenn ich dem grünen Männchen, das soeben vom Uranus her in meinem Vorgarten gelandet ist und mich mit singenden Klicklauten begrüßt, in Schweizerdeutsch zu erklären versuche, dass sein Ufo meine Tomaten plattdrückt. Der falsche Rückschluss wäre nun zu meinen, dass das Kreuz für eine kommende Generation keine Bedeutung mehr haben könnte. Vielmehr aber müssen wir wegkommen von der Verkürzung der Kreuzesdimension und ihrer Reduktion auf reine Schuldvergebung. Was Christus am Kreuz getan hat, übersteigt das reine Schuldvergeben bei weitem – nur leben wir seit Jahrhunderten mit einer Schmalspurversion des Kreuzes. Die Reduktion auf Schuldvergebung hatte nicht nur im mittelalterlichen Ablasshandel ihren Höhepunkt, sondern zieht sich ziemlich konsequent durch die vorherrschende Theologie hindurch. So ist auch „Umkehr“ immer gleichgesetzt mit „sich seiner Schuld bewusstwerden“. Es wäre spannend, sich nur schon mal der Frage anzunähern, was wäre, wenn eine Gesellschaft vielleicht gar nicht bis zu einem Punkt vordringt, an dem sie eine Schuldeinsicht hat? Wäre es möglich, dass Umkehr auch mit der Erkenntnis beginnt, dass man Christus als Entschämer benötigt, um die eigene Scham zu überwinden und in eine Gottesbeziehung hineinzukommen?
Nun sind solche Fragen nicht neu. Im Kontext der jüngeren deutschen Missionsforschung haben sich etwa Klaus W. Müller, Hannes Wiher, Lothar Käser oder Thomas Schirrmacher damit beschäftigt (das Buch Scham- oder Schuldgefühl? ist frei als PDF-Datei zu haben). Erst 2018 erschien das Buch Mit anderen Augen von Jayson Georges in deutscher Sprache, das den Blick für scham- und angstorientierte Kulturen weiten möchte (siehe dazu die hilfreiche Rezension von Tanja Bittner). Es gibt einen weitreichenden Konsens darüber, dass in der Heiligen Schrift sowohl Gerechtigkeit (Schuld), Ehre (Scham) als auch Macht (Furcht) eine Rolle spielen und eine angemessene Verkündigung diese Aspekte berücksichtigt.
Warum also das Thema nicht auch für die Missions- und Jüngerschaftsarbeit in Europa aktivieren? Ich kann einigen Fragen und Impulsen von Andreas Boppart etwas abgewinnen. Ich selbst halte beispielsweise eine Verkündigung, die sich einseitig an das Gewissen wendet, für defizitär.
Doch ich sehe gleichzeitig mehrere Problemfelder. So frage ich mich etwa (auf der rein empirisch-pragmatischen Ebene), ob die Verkündigung heute tatsächlich so sehr auf die Wahrheits- und Schuldfrage abzielt, wie Boppart das voraussetzt? Hören wir denn das Wort von dem heiligen Gott und der Vergebung der Sünden tatsächlich noch oft? Anders gefragt: Sind die Kirchen voll, in denen ein „ganzheitliches Evangelium“, das die Schuldfrage in den Hintergrund schiebt, angeboten wird? Auf den Kanzeln und christlichen Medien-Kanälen wimmelt es von „Du bist wertvoll“- und „Du bist so angekommen, wie Du bist“-Botschaften. Trotzdem stecken die Kirchen in einer geistlichen Krise. Es scheint so, also ob die Versicherung, „du bis ok und gehörst dazu“, die Sehnsucht der Menschen nicht stillen kann. Offensichtlich trägt diese Botschaft nicht durchs Leben. Und ich frage mich auch, ob es stimmt, dass wir in einem schamorientierten Europa leben? Vielleicht leidet Europa ja in einem gewissen Sinn mehr an seiner Schamlosigkeit als an der Schamsättigung?
Wie dem auch sei. Das eigentliche Problem einer „schamorientierten“ Jugendarbeit scheint mir noch tiefer zu liegen.
Was denken die Leser des TheoBlogs so darüber?
Hier der vollständige Kommentar (nur für Abonnenten): www.idea.de.
VD: BS