Das Ding an sich
Kurt Tucholsky:
Das Ding an sich muss noch gefunden werden; das Loch ist schon an sich.
Kurt Tucholsky:
Das Ding an sich muss noch gefunden werden; das Loch ist schon an sich.
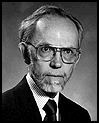 Der amerikanische Philosoph William P. Alston ist am 13. September 2009 zu Hause nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Alston war Professor an der Syracuse University und hat einige grundlegende Arbeiten zu Sprachphilosophie, Erkenntnistheorie und Religionsphilosophie publiziert.
Der amerikanische Philosoph William P. Alston ist am 13. September 2009 zu Hause nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Alston war Professor an der Syracuse University und hat einige grundlegende Arbeiten zu Sprachphilosophie, Erkenntnistheorie und Religionsphilosophie publiziert.
Zusammen mit Alvin Plantinga und Nicholas Wolterstorff hat er in den U.S.A. eine Wiederbelegung der christlichen Philosophie eingeleitet. Das Grundlagenwerk Faith and Rationality enthält seinen Aufsatz »Christian Experience and Christian Belief«.
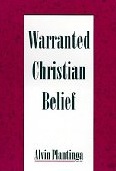 Warranted Christian Belief ist wahrscheinlich das reifste Buch des Philosophen Alvin Plantinga (siehe auch Ist der Glaube an Gott rational?).
Warranted Christian Belief ist wahrscheinlich das reifste Buch des Philosophen Alvin Plantinga (siehe auch Ist der Glaube an Gott rational?).
Plantinga geht in diesem 505-Seiten-Werk der Frage nach, ob der christliche Glaube an Gott vernünftig gerechtfertigt und gewährleistet (eng. warranted) ist. Er kommt zu dem Ergebnis, dass dieser Glaube unabhängig von den Argumenten der natürlichen Theologie basal gewährleistet sein kann, wenn er wahr ist.
Der Text dieses bedeutenden Buches steht nun online: www.ccel.org.
Mein Kollege Thomas K. Johnson stellt drei Schulrichtungen der niederländisch-reformierten Philosophie in Nord Amerika vor (Nicholas Wolterstorff und Alvin Plantinga, Herman Dooyerweerd und Dirk Vollenhoven sowie Cornelius Van Til):
Die drei Richtungen kann man als »Neue Reformierte Erkenntnistheorie«, »Philosophie der kosmonomischen Idee« und als »reformierten Transzendentalismus« bezeichnen. Die ersten beiden Bezeichnungen werden von den Trägern dieser Richtungen selbst benutzt. Ich habe für die Richtung, die sich selbst »Presuppositionalismus« nennt, den Namen »reformierter Transzendentalismus« gewählt, weil das meiner Meinung nach diese Art von Philosophie besser beschreibt. Die führenden Köpfe der »Neuen Reformierten Erkenntnistheorie« sind Nicholas Wolterstorff (Yale Divinity School) und Alvin Plantinga (Notre Dame University), deren Grundgedanken von Denkern wie Ronald Nash und Dewey Hoitinga aufgenommen und weiterverbreitetet wurden. Return to Reason von Kelly James Clark kann als nützliches Kompendium für diese Philosophie dienen.
Die »Philosophie der kosmonomischen Idee« wurde von amerikanischen und kanadischen Anhängern der holländischen Gelehrten Herman Dooyerweerd und Dirk Vollenhoven entwickelt. Gordon Spykman hat die Konsequenzen, die sich aus dieser Philosophie für die systematische Theologie ergeben, untersucht. Roy Clouser hat dasselbe für die Theorie der Erkenntnis und der Vernunft unternommen, Al Wolters tat dies für das Studium von Weltanschauung und Hendrik Hart für die systematische Philosophie. Währenddessen hat James Skillen aus diesem philosophischen Ansatz heraus zahlreiche Bücher über Bildungstheorie und politische Theorie verfasst. Patterns of the Western Mind von John H. Kok bietet im Blick auf diese zweite Richtung eine gute Einführung.
Der »Reformierte Transzendentalismus« umfasst zum großen Teil das Werk von Cornelius Van Til (1895–1987). Van Til fühlte sich stark den holländischen Theologen Abraham Kuyper und Herman Bavinck verpflichtet. Seine Ansichten wurden von Autoren wie John Frame, Richard Smith und Scott Oliphant weiterentwickelt und verbreitet. Van Til’s Apologetic: Readings and Analysis von Greg L. Bahnsen ist eine gründliche Einführung in diese dritte Richtung.
Hier der Aufsatz: »Ist der Glaube an Gott rational?«: mbstexte120.pdf.
 Guru Peter Sloterdijk stellt in einem Interview mit der FAZ sein neues Buch »Du musst dein Leben ändern« vor und erklärt uns, was sich ändern muss, damit die Menschheit überlebt.
Guru Peter Sloterdijk stellt in einem Interview mit der FAZ sein neues Buch »Du musst dein Leben ändern« vor und erklärt uns, was sich ändern muss, damit die Menschheit überlebt.
Diesmal hat Sloterdijk die Weltrettungsformel gefunden und vermarktet sie unter dem Namen ›Ko-Immunismus‹.
Ich gehe von einer starken ontologischen These aus: Intelligenz gibt es. Aus ihr folgt eine starke ethische These: Intelligenz existiert in positiver Korrelation mit dem Willen zur Selbstbewahrung. Seit Adorno wissen wir, dass diese Korrelation in Frage gestellt werden kann – das war die suggestivste Idee der älteren Kritischen Theorie. Sie ging von der Beobachtung aus, dass die Intelligenz sich in der Richtung irren kann und Selbstzerstörung mit Selbsterhaltung verwechselt. Dies gehört zu den unvergesslichen Lektionen des zwanzigsten Jahrhunderts. Was jetzt auf der Tagesordnung steht, ist eine affirmative Theorie der globalen Ko-Immunität. Sie begründet und orientiert die vielfältigen Praktiken des gemeinsamen Überlebens.
Hier das Interview: www.faz.net.
Am 21. Februar veranstaltete die bedeutendste amerikanische philosophische Gesellschaft (APA) so etwas wie eine Debatte über die Existenz Gottes. Die theistische Position wurde von Alvin Plantinga vertreten. Plantinga gilt vielen als der herausragendste christliche Philosoph seit dem Mittelalter und tatsächlich ist er mitverantwortlich dafür, dass in den U.S.A. die Religionsphilosophie eine Renaissance erfährt und viele Christen wieder Philosophie studieren. Daniel Dennett ist ein bedeutender Vertreter des »Neuen Atheismus« und ein darwinistischer Religionskritiker. Vielen gilt er als einer der führenden Vertreter der »Philosophie des Geistes« (Philosophy of Mind).
In der Debatte versuchte Plantinga zu zeigen, dass eine nicht-naturalistische Form der Evolutionstheorie mit einem theistischen Glauben vereinbar sei. Der Naturalismus sei allerdings eine Quasi-Religion und stünde im Widerspruch zur Wissenschaft. Der Theismus sei rational vertretbar, sogar dann, wenn er mit einigen Ergebnissen der Wissenschaft kollidiere. Grundsätzlich behaupte er aber die Verträglichkeit von Glaube und Wissenschaft (»there is no conflict between theistic religion and science«).
Daniel Dennett antwortete Plantinga überwiegend mit Spott. Für ihn sei der Theismus inakzeptabel und irrational, vergleichbar mit der Astrologie. »Ist Plantinga’s Theismus in einer besseren Lage als all diese anderen Phantasien?«, fragte er.
Freundlicherweise hat ein Teilnehmer der Diskussion, der nicht mit Namen genannt werden möchte, seine (mit köstlichem Humor gewürzten) Eindrücke schriftlich festgehalten und in einem Blog publizieren lassen. Sein Resümee:
In my estimation, Plantinga won hands down because Dennett savagely mocked Plantinga rather than taking him seriously. Plantinga focused on the argument, and Dennett engaged in ridicule. It is safe to say that Dennett only made himself look bad along with those few nasty naturalists that were snickering at Plantinga. The Christians engaged in no analogous behavior. More engagements like this will only expand the ranks of Christian philosophers and increase the pace of academic philosophy’s desecularization.
Aber lesen Sie am besten die ganze Geschichte (und die dazugehörenden Kommentare) selbst. Leider – wie so oft – nur auf Amerikanisch: prosblogion.ektopos.com.
Vor 30 Jahren starb Michel Foucault. Jürg Altwegg hat für die FAZ die letzten Tage des französischen Philosophen nachgezeichnet sowie die merkwürdige Verdrängung seiner Fehlleistungen thematisiert.
Im Lob seiner intellektuellen Ethik und Philosophie der Sexualität, das jetzt angestimmt wird, erinnert aus Anlass von Foucaults Todestag wie des dreißigsten Jahrestags der islamischen Revolution in Iran kein Mensch an Foucaults Unterstützung der Ajatollahs. Das Buch von Janet Afary und Kevin B. Anderson über »Foucault and the Iranian Revolution« ist nie auf Französisch erschienen. Die Autoren erklären seine blinde Hymne auf Chomeini, der im Februar 1979 die Macht übernahm, mit dem Hass des Denkers auf die politischen und wirtschaftlichen Systeme, auf den Staat und den Kapitalismus. Sie wird bei den laufenden französischen Foucault-Fest-und-Trauerspielen genauso ausgeblendet wie die verschämte Verlogenheit, mit der nach seinem Tod um dessen Ursache herumgeredet wurde. Auch in den Debatten über die psychiatrischen Kliniken, die Sarkozy in Hochsicherheitstrakte verwandeln will, und die Gefängnisse, aus denen wöchentlich Selbstmorde gemeldet werden, ist er merkwürdigerweise überhaupt nicht präsent.
Hartnäckig wird Foucaults Faszination für Chomeinis Revolution verdrängt. Und fast ebenso systematisch die Reise der »Tel Quel«-Redaktion 1974 nach China verharmlost.
Über die zahlreichen Merkwürdigkeiten bei Foucault gäbe es so viel zu sagen.
Hier der vollständige Beitrag von Jürg Altwegg: www.faz.net.

Heinzpeter Hempelmann, Daniel Renz und ich ringen um eine angemessene Deutung des nietzscheanischen Jesusbildes. Während für Heinzpeter bei Nietzsche dort das Evangelium aufblitzt, wo er von Jesus fasziniert ist, vermute ich, dass der Jesus des Nietzsche mit dem Christus der Evangelien nicht viel zu tun hat.
Wer sich für das Thema interessiert oder sich konstruktiv am Gespräch beteiligen möchte, ist gewiss bei Daniel en blog herzlich willkommen: www.daniel-renz.de.
 Malte Henk hat für das Magazin DER SPIEGEL einen Beitrag über den Gottesbeweis von Anselm von Canterbury geschrieben. Der Artikel ist gut lesbar und ermöglicht auch dem theologisch oder philosophisch wenig trainiertem Leser ein Nachdenken des ontologischen Beweises. Henk resümiert: »Das Verdienst des Anselm von Canterbury aber bleibt bestehen. Als einer der ersten Denker hat er die Christenheit gelehrt, dass Glaube und Vernunft einander nicht ausschließen müssen.«
Malte Henk hat für das Magazin DER SPIEGEL einen Beitrag über den Gottesbeweis von Anselm von Canterbury geschrieben. Der Artikel ist gut lesbar und ermöglicht auch dem theologisch oder philosophisch wenig trainiertem Leser ein Nachdenken des ontologischen Beweises. Henk resümiert: »Das Verdienst des Anselm von Canterbury aber bleibt bestehen. Als einer der ersten Denker hat er die Christenheit gelehrt, dass Glaube und Vernunft einander nicht ausschließen müssen.«
Zur Ergänzung hier noch einige Notizen aus meiner Vorlesung im Fach Apologetik:
Der Philosoph, der der Frühscholastik ihre eigentümliche Prägung gab, heißt Bischof Anselm von Canterbury (1033–1109). Anselm gilt als einer der originellsten christlichen Denker überhaupt und findet nach wie vor innerhalb der Philosophie große Beachtung. Dass er in der Denktradition Augustins aufwuchs, lässt sich schon an diesem wunderschönen Gebet ablesen, das er zum Eingang seines Gottesbeweises niederschrieb:
Ich bekenne, Herr, und sage Dank, dass Du in mir dieses Dein Bild erschaffen hast, auf dass ich, Deiner eingedenk, Dich denke, Dich liebe. Aber so sehr ist es durch das nagende Laster zerstört, so sehr durch den Rauch der Sünden geschwärzt, dass es nicht bewirken kann, wozu es gemacht ist, wenn Du es nicht wieder neu machst und wieder herstellst. Ich versuche nicht, Herr, Deine Tiefe zu durchdringen, denn keineswegs messe ich meinen Verstand mit ihr; doch ein wenig will ich Deine Wahrheit verstehen, die mein Herz glaubt und liebt. Ich suche ja auch nicht zu verstehen, um zu glauben, sondern glaube, um zu verstehen. Denn auch das glaube ich: Wenn ich nicht glaube, werde ich nicht verstehen (lat. »quia: ›nisi credidero, non intelligam‹«).
Wie Augustinus geht es Anselm um einen verstehenden Glauben (credo ut intelligam). Seine Argumentationen lassen sich sehr gut als Ausdruck des Glaubens verstehen. Als ein Glaubender sucht er das, was er glaubt, vernünftig zu durchleuchten.
Neben dem Proslogion, das dem Dasein Gottes gewidmet ist, verfasste Anselm mit dem Monologium noch eine Schrift über die Weisheit Gottes. Von Anselm stammt außerdem die erste systematische Theorie des Wahrheitsbegriffs innerhalb der abendländischen Philosophiegeschichte, die den Titel De veriate trägt und ca. 1082–1085 n. Chr. entstand. Eine bedeutende Wirkungsgeschichte entwickelte seine Ausarbeitung Cur Deus homo?, in der er die Auffassung vertritt, die Erlösung durch Christus sei als Befriedigung des gerechten Zornes Gottes durch den Tod Christi zu verstehen (Satisfaktionslehre). Dass besonders sein Buch Proslogion (dt. Anrede) für die Apologetik interessant ist, zeigt seine Bemerkung zur Intention des Werkes in der Vorrede:
Auf drängende Bitten einiger Mitbrüder hin hatte ich ein kleines Werk herausgegeben, gleichsam als Beispiel, wie man über den Grund des Glaubens nachsinnt. Dabei hatte ich die Rolle von jemandem übernommen, der still bei sich überlegt und dem nachforscht, was er nicht weiß. Da ich sah, dass die Schrift aus einer Verkettung vieler Argumente zusammengesetzt ist, begann ich mich zu fragen, ob sich nicht vielleicht ein Argument finden lasse, das keines anderen als seiner allein bedürfe, um sich zu beweisen, und das allein genüge, um sicherzustellen, dass Gott wahrhaft ist und dass er das höchste Gut ist, das keines anderen bedarf und dessen alles bedarf, um zu sein und gut zu sein und alles, was wir von der göttlichen Wesenheit glauben.
Anselm wollte einen Gottesbeweis finden, der alle anderen Gottesbeweise in den Schatten stellte. Einen Gottesbeweis, der ein für alle Mal sichert, »dass Gott wahrhaft ist«. Es verwundert nicht, dass dieser Gottesbeweis ihm einen herausragenden Platz in der Philosophiegeschichte verschafft hat.
Schauen wir uns die Argumentation seines Beweises etwas genauer an. Anselm glaubt, dass Gott etwas ist, über »das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann« (Proslogion II, 2). Und weil nichts Größeres als Gott gedacht werden kann, exisitiert Gott nicht ausschließlich im Verstande. Anselm schreibt (Proslogion II, 9–13):
Und gewiss kann das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, nicht allein im Verstände sein. Denn wenn es nur im Verstände allein ist, so kann man denken, es sei auch in der Wirklichkeit, was größer ist. Wenn also das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, im Verstände allein ist, so ist eben das, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, dasjenige, über das hinaus Größeres gedacht werden kann. Das aber kann mit Sicherheit nicht der Fall sein. Es existiert also ohne Zweifel etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, [und zwar] sowohl im Verstände als auch in der Wirklichkeit.
Die Vernunft findet in sich die Idee des höchsten denkbaren Wesens vor. Existierte dieses Wesen allein im Denken der Vernunft, wäre es nicht das höchste Wesen, weil dann noch ein höheres Wesen gedacht werden könnte, nämlich ein Wesen, dass nicht nur in der Vorstellung, sondern auch in der Wirklichkeit existierte. Deshalb verlangt der Begriff eines höchsten Gottes, dass dieser nicht nur im Denken, sondern auch in der Wirklichkeit existiere.
Der Gedanke ging als der sogenannte Ontologische Gottesbeweis in die Ideengeschichte ein. Schon zu Lebzeiten Anselms wies der Mönch Gaunilo darauf hin, dass die Existenz kein Merkmal des Begriffs ist. Wenn ich eine vollkommene Insel denke, so folge daraus nicht ihre Existenz. Im 18. Jh. behauptete Immanuel Kant, dass dann, wenn ich an 100 Taler in meiner Tasche denke, sie nicht notwendig vorhanden sind. Für Kant können Begriffe allein kein Dasein des Bezeichneten sichern, da das Dasein kein Merkmal des Begriffs ist.
Analysieren wir den Beweis kurz:
(1) Gott ist das höchste existierende Wesen.
(2) Gott besitzt deshalb alle Eigenschaften.
(3) Existenz ist eine Eigenschaft.
∴ Gott existiert.
Das Problem besteht darin, dass hier Existenz als eine Eigenschaft unter vielen verstanden wird, vergleichbar mit einer Farbe, einer Form oder einem Stoff. Innerhalb der Philosophie wird aber zurecht zwischen dem Dasein (existentia) und dem Sosein (essentia) unterschieden. Differenziert man nicht in diesem Sinne, nimmt man einem Gegenstand x seine Existenz, wenn man ihm seine Eigenschaften nimmt.
Für Anselm selbst und viele andere Theologen können solche Argumente den Beweis nicht entkräften. Für sie ist Gott ein Sonderfall. Bei einem vollkommenen Wesen gibt es die ontologische Differenz zwischen dem Dasein und Sosein nicht, schon allein aus dem Wesen folgt die Existenz. Der Grund dafür liegt darin, dass Anselm einer anderen ideengeschichtlichen Tradition angehört als später Thomas von Aquin oder die Philosophen der Neuzeit. Anselm leitet Begriffe nicht nur aus der sinnlichen Erfahrung, sondern von den vollkommenen Ideen ab. Dort also, wo in der Tradition Platons gedacht wird, erfreut sich der von Anselm vorgetragene Existenzbeweis Gottes weiterhin großer Beachtung (jüngst hat übrigens Friedrich Hermanni eine Rehabilitierung des ontologischen Beweises versucht: »Der ontologische Gottesbeweis« in: NZSTh, Bd. 44, 2002, S. 245–267).
Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz hat eine hilfreiche Handreichung zur Trinitätstheologie herausgegeben. Im ersten Teil wird auf verständliche Weise zum Glauben an den dreieinen Gott im Kontext der Postmoderne Stellung genommen. Die Autoren verweisen auf postmoderne Kritik an der trinitarischen Theologie und stellen dabei fest (Der Glaube an den dreieinen Gott, 2006, S. 22–24):
(a) Innerhalb der Gotteslehre bedeutet die Rezeption der postmodernen Denkform radikale Kritik an jeder Vorstellung von Gott als Ursprung, sei es als Schöpfer der Welt, sei es als Quelle der Wahrheit, sei es als moralischer Gesetzgeber.
(b) Das missionarische Ziel eines universalen Bekenntnisses zu ein und demselben Gott steht aus postmoderner Sicht nicht nur unter dem Verdikt der Illusion, sondern auch unter dem Verdacht der imperialen Unterwerfung.
(c) Die postmoderne Kritik an einem Denken der Präsenz bzw. Repräsentanz und das damit gegebene Votum für die Annahme radikaler Transzendenz des Absoluten stehen in einem unüberbrückbaren Gegensatz zu dem biblisch bezeugten »Ich-bin-da« Gott (Ex 3,14). Denn der biblische Monotheismus bezeichnet den einen und einzigen Gott nicht nur als transzendenten Ursprung aller Wirklichkeit, sondern auch als Raum und Zeit konkret beanspruchende Instanz. Von daher kann kaum überraschen, dass das christliche Dogma von der Fleischwerdung des alles Seiende begründenden Logos von postmodernen Autoren als die intoleranteste Zuspitzung jedes theologischen Einheitsdenkens (Monotheismus) bezeichnet wird.
(17) Wer im Dienst der Verkündigung steht, sollte wissen, warum die Inhalte des christlichen Credo heute sehr viel schwerer als zu früheren Zeiten vermittelt werden können. Die postmoderne Denk- und Lebensform ist wie ein Sog, dem natürlich auch praktizierende Christinnen und Christen als »Kinder ihrer Zeit« ausgesetzt sind. Auch mit der Verkündigung beauftragte Männer und Frauen sind nicht selten versucht, den Glauben an den einen und einzigen, allein in Jesus Christus personal offenbaren Gott zu relativieren und diese Form der Relativierung mit Achtung vor der Überzeugung des Andersdenkenden zu verwechseln. Das Wort »Gott« bezeichnet für immer mehr Menschen ein transzendentes Wesen, das da ist, wo sie nicht sind; das vielleicht auf den Plan tritt, wenn dieses Leben zu Ende geht; das vielleicht da und dort ein Wunder wirkt, das aber in aller Regel so weit entfernt ist vom eigenen Leben wie ein Fixstern von der Erde. Die zentralen Begriffe des christlichen Glaubensbekenntnisses – Schöpfung, Inkarnation, Erlösung, Trinität – verflüchtigen sich auf Grund einer zunehmenden Trennung alles Sicht- und Fassbaren von der »Sphäre der Transzendenz«. Diese Konstante postmoderner Denk- und Lebensform gewinnt ihre Durchschlagskraft aus Erfahrungen der jüngsten Geschichte. Immer weniger Menschen können nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, nach der Ermordung von sechs Millionen Juden oder angesichts der täglich im Fernsehen auftauchenden Bilder von Kriegen, Katastrophen, Vertreibungen und Verbrechen noch an einen Gott glauben, der »da ist«, der sich ansprechen lässt und helfen kann. Wo – so fragen auch praktizierende Christen – liegt der Unterschied in den Schicksalen derer, die beten, zu den Schicksalen derer, die nicht beten? Viele sehnen sich nach Sinn und Geborgenheit; sie sehnen sich nach einem Glauben, der ihr Leben trägt. Aber sie können die Inhalte der kirchlichen Tradition nicht mehr in Einklang bringen mit den eigenen Lebenserfahrungen. Viele suchen deshalb Ersatz in Erfahrungen meditativer, mystischer oder heilpraktischer Art.
Die Handreichung kann bei der Deutschen Bischofskonferenz bestellt oder im Internet frei herunter geladen werde: www.dbk.de.