„Die wahre Quelle allen Rechtes“
Nach Auffassung des sogenannten Rechtspositivismus gilt als Recht allein das, was der Gesetzgeber als solches verabschiedet hat. Eine Beurteilung des Rechts an moralischen Maßstäben verbietet sich in rechtspositivistischen Gesellschaften, weil es keine einheitlichen Moralvorstellungen gibt. Jegliches Recht ist von Menschen gemacht. Falls diese meinen, wir brauchen ein neues Ehe- und Familienverständnis, dann wird eben ein „Ehe für alle“-Gesetz beschlossen.
In Abgrenzung zu diesem Rechtspositivismus vertritt das Naturrecht, dass Recht und Moral nicht so einfach voneinander getrennt werden kann. Etwas ist Recht oder Unrecht, weil es uns mit der Natur gegeben ist. Eltern die Kinder wegzunehmen, ohne das es dafür schwerwiegende Gründe gibt, ist demnach Unrecht – egal was das positive Recht dazu sagt. Alle vom Menschen gemachten Gesetze müssen an der Moral gemessen werden. Nur Gesetze, die diesen moralischen Ansprüchen des Naturrechts genügen, können den Anspruch erheben, befolgt zu werden. So waren viele Gesetze der Nationalsozialisten – etwa die Rassengesetze – objektives Unrecht.
Die „modernen Gesellschaften“ haben sich weitgehend von einem höheren Gesetz oder einer höheren Ordnung verabschiedet. Der Mensch tritt als alleiniger Gesetzgeber auf. Das macht es Despoten leicht, ihre eigenen Interessen auch rechtlich durchzusetzen. Sie haben in den Augen der Positivisten schlichtweg andere Werte. Mangels eines übergeordneten Maßstabs ist es im strengen Sinne unmöglich, zu behaupten, irgendein Wertsystem sei besser als ein anderes.
Der Philosoph Robert Spaemann (1927–2018), selbst Verfechter einer Naturrechtsposition, hat einmal anhand eines persönlichen Erlebnisses demonstriert, dass der Rechtspositivismus eine „Schönwettertheorie“ ist. Spaemann schreibt in „Warum gibt es kein Recht ohne Naturrecht?“ (in: Hanns-Gregor Nissing (Hg.), Naturrecht und Kirche im säkularen Staat, 2016, S. 27–34, hier S. 27):
Nach dem Krieg hörte ich in Münster auf dem Domplatz eine Predigt des Kardinals von Galen vor dem zerstörten Dom. Der Domplatz war schwarz vor Menschen, und der damalige Bischof, Clemens August, sagte: „Eurer Liebe verdanke ich mein Leben.“ Dann fügte er mit donnernder Stimme hinzu: „Was wir jetzt erlebt haben, die Tyrannei, die Unterdrückung, die Zerstörung, das alles war die Strafe Gottes für das, was die Deutschen 1919 an den Anfang ihrer Verfassung gestellt haben: ‚Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.’ Jetzt haben wir die Staatsgewalt kennen gelernt, die vom Volke ausgeht. Es wird Zeit, dass wir uns besinnen auf die wahre Quelle allen Rechtes.“
Nach den grauenhaften Tyranneien des 20. Jahrhunderts ist der Rechtspositivismus eigentlich kaum zu retten. Er ist eine Schönwettertheorie. Er entzieht der Verurteilung von Staatsverbrechen jede objektive Grundlage. Wenn der Wille des Gesetzgebers an keinen ihm vorgegeben Maßstab des Richtigen und des Falschen, des Guten und des Schlechten gebunden ist, und wenn die Verkündigung im Gesetzblatt eines Staates die höchste Legitimation der Gesetze ist, dann kann es keine Rechtfertigung geben, die den Bürger auf irgend eine Weise im Gewissen binden kann.
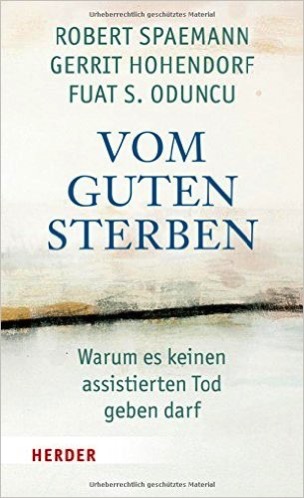 Stephan Sahm schreibt in seiner Rezension:
Stephan Sahm schreibt in seiner Rezension: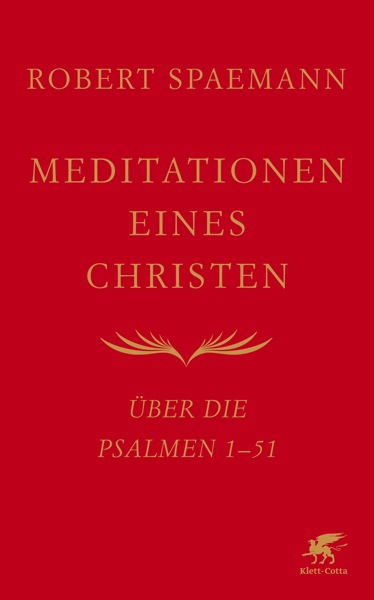 Der Band Meditationen eines Christen enthält besinnliche Auslegungen zu den ersten 51 Psalmen. Verfasst sind sie von Robert Spaemann. Spaemann, geboren 1927 in Berlin, zählt zu den wenigen christlichen Philosophen, die es in Deutschland noch gibt. Er besuchte, gemeinsam mit Odo Marquard, Günter Rohrmoser oder auch Ernst-Wolfgang Böckenförde Anfang der 50er-Jahre Seminare bei Joachim Ritter in Münster und promovierte unter ihm. Später habilitierte er sich in den Fächern Philosophie und Pädagogik und lehrte in Stuttgart, Heidelberg und seit 1972 in München Philosophie.
Der Band Meditationen eines Christen enthält besinnliche Auslegungen zu den ersten 51 Psalmen. Verfasst sind sie von Robert Spaemann. Spaemann, geboren 1927 in Berlin, zählt zu den wenigen christlichen Philosophen, die es in Deutschland noch gibt. Er besuchte, gemeinsam mit Odo Marquard, Günter Rohrmoser oder auch Ernst-Wolfgang Böckenförde Anfang der 50er-Jahre Seminare bei Joachim Ritter in Münster und promovierte unter ihm. Später habilitierte er sich in den Fächern Philosophie und Pädagogik und lehrte in Stuttgart, Heidelberg und seit 1972 in München Philosophie.