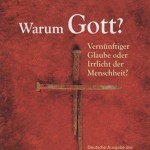Das Bücherfeuer von Düsseldorf
Ich habe Jesus Christus im Rahmen einer Arbeit des »Jugendbundes für Entschiedenes Christentum« (EC) kennengelernt. Gern denke ich an diese Tage zurück, in denen wir uns als Jugendliche mehrmals in der Woche getroffen haben, um gemeinsam Bibel zu lesen, zu diskutieren oder Sport zu treiben. Es war eine (zumindest für mich und viele andere) gesegnete Zeit.
Ein Thema löste damals in meinem Düsseldorfer EC gelegentlich eine gewisse Verlegenheit aus. Ich spreche von der Bücherverbrennung im Herbst 1965. Ungefähr 25 EC’ler trafen sich am Rheinufer, um während einer behördlich angemeldeten Veranstaltung so genannte Schmutz- und Schundliteratur zu verbrennen. Unter Klampfenbegleitung sangen die jungen Leute christliche Lieder und verbrannten Bücher wie Lolita, Die Blechtrommel oder Der Fall.
Das Ereignis löste nicht nur beim EC Jugendverband Krisensitzungen aus, sondern fand auch sonst reges Interesse bei der Presse. Sogar eine elitäre Wochenzeitschrift nahm sich der Sache an und publizierte einen umfangreichen Artikel mit dem Titel »Ein Licht ins dunkle deutsche Land«. Ferdinand Ranft schrieb damals für DIE ZEIT:
Der Plan, in der Öffentlichkeit Bücher zu verbrennen, wurde von dem Düsseldorfer Jugendbund schon am 22. August in der sonntäglichen Gruppenstunde gefaßt. Den Anstoß dazu gab ein Rundgespräch über die Wochenlosung, die sich in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, findet. Es heißt dort in Vers 18 und 19 über die dritte Missionsreise des Paulus nach Ephesus: »Es kamen auch viele derer, die gläubig waren geworden, und bekannten und verkündigten, was sie getrieben hatten. Viele aber, die da vorwitzige Kunst getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich …«
In ihrem Eifer, eine spektakuläre Tat für die »Sauberkeit und Reinheit ihrer Umwelt« zu vollbringen, übersahen die jungen Leute ebenso wie die Gruppenleiterin … völlig, daß sie zunächst einmal der Wochenlosung eine theologisch unhaltbare Interpretation untergeschoben hatten. Die Epheser hatten keineswegs Werke der antiken Literatur verbrannt, sondern heidnische Zauberbücher, Werke der »Schwarzen Magie«. Doch einmal auf dem falschen Wege, war die Aktivität der Jungen und Mädchen nicht mehr aufzuhalten.
Mal davon abgesehen, dass der lukanische Bericht von der Bücherverbrennung in Ephesus überinterpretiert wurde (Kontext sind Schuldbekenntnis und die öffentliche Abwendung von der Zauberei (!) unter Inkaufnahme enorme finanzieller Verluste – 1 Drachme entsprach damals etwa einem Tageslohn. Außerdem ist es ein Bericht, keine Empfehlung zur Nachahmung.), hatten die wirklich ganz lieben Leute vom EC vollkommen ausgeblendet, dass die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten nur gute 30 Jahre zurücklagen.
Wenn ich nun lese, dass irgendwelche fromme Christen in Florida zu einer öffentlichen Verbrennung des Korans aufgerufen haben, kann ich nur entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie können Leute so unüberlegt handeln? Von den Nazis mögen diese Leute in Florida noch nicht viel gehört haben. Sie wissen aber, dass wir heute in einem globalen Dorf leben. Sie setzten ja genau darauf, dass die Welt inzwischen flach ist und allerorten über diese Veranstaltung berichtet wird. In den USA mag so eine Aktion medialen Protest auf sich ziehen und das Image der Evangelikalen noch mehr in den Dreck ziehen, in manchen Ländern dieser Welt kann so ein Unfug das Leben von völlig unbeteiligten Menschen gefährden!
Da bin ich froh, dass die Evangelische Allianz als Netzwerk für die Evangelikalen sich deutlich distanziert hat und fordert, diese Buchverbrennung abzusagen.