 Beim Verlag Vandenhoeck & Ruprecht ist kürzlich das bemerkenswerte Buch:
Beim Verlag Vandenhoeck & Ruprecht ist kürzlich das bemerkenswerte Buch:
- Mark Jones u. Michael A. G. Haykin (Hg.): Drawn into Controversie: Reformed Theological Diversity and Debates Within Seventeenth-Century British Puritanism, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, 336 S., 84,95 €
erschienen.
Nachfolgende eine Rezension zum Buch. Ich danke an dieser Stelle Ivo sehr herzlich für die Übersetzung der Zitate.
– – –
Rezension: Drawn into Controversie
Der 17. Band der von Herman J. Selderhuis verantworteten Reihe Reformed Historical Theology vereint zwölf Aufsätze über theologische Debatten unter den englischen Puritanern in der Zeit des 17. Jahrhunderts. Die Herausgeber Michael Haykin und Mark Jones konnten für diese Untersuchung namhafte Fachleute auf dem Gebiet der reformierten Orthodoxie gewinnen.
Im einleitenden Kapitel hebt Richard A. Muller, Herausgeber des viel beachteten vierbändigen Werkes Post-Reformation Reformed Dogmatics (2. Aufl., Grand Rapids, MA: Baker, 2003) hervor, dass die reformierte Tradition, die nicht auf Calvin oder Musculus, sondern auf Bucer, Zwingli, Capito und Oecolampadius zurückgeht, keine durchweg homogene Theologie überliefert hat. Bisher nehmen innerreformierte Meinungsverschiedenheiten in den diversen theologischen Untersuchungen verhältnismäßig wenig Raum ein. Die hier publizierten Aufsätze erörtern einige der Kontroversen und korrigieren die prominente »Calvin gegen die Calvinisten«-Lesart. Johannes Calvin war eben nicht Gründer und alleinige Norm der reformierten Theologie. Die Behauptung, dass sich nach dem Tod des Genfer Reformators unter dem Einfluss scholastischer Theologen eine erstarrte reformierte Orthodoxie entwickelte, die gegen den »humanistischen Christozentrismus« Calvins auszuspielen sei, wird – so Muller – dem komplexen Entwicklungsprozess der reformierten Theologie nicht gerecht (S. 12).
Alan S. Strange untersucht nachfolgend die Thematik der »Anrechnung des aktiven Gehorsams von Jesus Christus« bei der puritanisch-presbyterianischen Synode von Westminster (S. 31–51). Während das Westminster Bekenntnis die Anrechnung des aktiven Gehorsams mit Rücksicht auf die Rechtfertigungslehre bestätigt (vgl. Artikel 11.1), wurde das Thema außerhalb der Synode vor und nach 1643 kontrovers diskutiert. Die meisten Gelehrten bekräftigten freilich die Lehre von der »Imputation« (S. 50).
Bei den sogenannten »Unabhängigen Brüdern« handelt es sich um eine kleine Gruppe englischer Theologen, die entschieden für die Selbstverwaltung der lokalen Gemeinden eingetreten ist. Diese Puritaner um Thomas Goodwin gingen 1630 in das holländische Exil und publizierten zur Zeit der Westminstersynode das berühmt gewordene Traktat Apologeticall Narration. Während die meisten Historiker der Synode davon überzeugt waren, dass allein der »Presbyterianismus« eine stabile englische Kirchenpolitik sichern könne, plädierten die »Unabhängigen« für die Autonomie der einzelnen Gemeinden (Kongregationalismus) und gerieten damit unter den Verdacht des Separatismus. Hunter Powell untersucht den Fall in seinem Aufsatz »October 1643: The Dissenting Brethren and the Proton Dektikon« (S. 52–82).
Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts haben die reformierten Kirchen Europas den Glauben an ein irdisches Tausendjähriges Reich einheitlich abgelehnt. Nach dem Wegfall der Zensur wurde jedoch der Konsens von millennialistisch ausgerichteten Publikationen in Frage gestellt. So brach Thomas Brightmann (1562–1607) in seinem Kommentar zu Offb 20,1–10 mit der augustinisch-reformatorischen Auslegungstradition und wagte zu behaupten, dieser Text beziehe sich auf zwei Zeitabschnitte zu jeweils eintausend Jahren, von denen der erste schon vergangen sei. »Also begannen die ersten tausend Jahre (Offb 20,1–3) ca. um 304 n.Chr. und endeten um 1300 n.Chr., nachdem die Freilassung Satans durch die islamische Invasion Europas offenkundig geworden war« (S. 85). Die zweiten tausend Jahre (Offb 20,4–10) begannen mit der Wiederbelebung der wahren Theologie zur Reformationszeit – eine Erweckung, die Brightmann sogar mit der »ersten Auferstehung« identifizierte. »Der Anfang der Herrschaft der Heiligen mit Christus sollte – so glaubte er – in ein ›weltweites presbyterianisches Utopia‹ münden« (S. 85). Crawford Gribbens anregende Untersuchung zum »Millennialismus« (S. 83–98) legt dar, dass ab Mitte des 17. Jahrhunderts »millennialistische Eschatologien« im europäischen und nordamerikanischen Protestantismus mehr Einfluss gewannen und mit immer größerem Ernst auf eine irdische »Millenniumshoffnung gesetzt« wurde.
J.V. Fesco widmet dem Disput über Supra- bzw. Infralapsarismus auf der Synode von Dordrecht seinen Aufsatz (S. 99–123). Die dogmatische Auseinandersetzung über die richtige Interpretation der göttlichen Dekrete hinsichtlich der Bestimmung des Menschen spielte in Dordrecht eine zentrale Rolle. Die Supralapsarier verorten die Prädestination vor der Erschaffung des Menschen, die Infralapsarier lassen die erwählenden Beschlüsse Gottes dem zugelassenen Fall folgen. Die Dordrechter Synode bekannte sich zur infralapsarischen Sichtsweise, verurteilte die supralapsarische Position indessen aber nicht. Die komplexe Frage wurde in »den Bereich der Privatauffassungen« verwiesen (S. 123). In der abschließenden Lehrregel und bei der Definition der Verwerfung achtete man sorgfältig darauf, Gott nicht zum Urheber der Sünde werden zu lassen. Lehren, die aus Gott einen Ungerechten, Tyrannen oder Heuchler machten, seien nichts anderes als »verfälschter Stoizismus, Manichäismus, Libertinismus« (S. 122). Im Schlusskommentar spielt die Lehrregel vage auf die Debatte zum Thema Infralapsarismus contra Supralapsarismus an: »Zuletzt ermahnt diese Synode alle Mitpriester im Evangelium Christi, bei Durchnahme dieser Lehre in Schulen und Kirchen fromm und gottesfürchtig zu Werke zu gehen, sie sowohl mündlich als auch schriftlich zum Ruhm des göttlichen Namens, zur Heiligkeit des Lebens und zum Trost niedergeschlagener Gemüter anzuwenden, mit der Schrift nach der Gleichmäßigkeit des Glaubens nicht nur zu denken, sondern auch zu sprechen und sich endlich aller der Ausdrücke zu enthalten, welche die uns vorgeschriebenen Grenzen des richtigen Sinnes der heiligen Schriften überschreiten und den nichtswürdigen Sophisten eine gute Gelegenheit bieten könnten, die Lehre der reformierten Kirche zu verhöhnen oder zu verleumden« (S. 122–123). Das Fazit J.V. Fescos lautet: »Für manche steht die Synode von Dordrecht für alles Rückständige und Starre innerhalb der reformierten Orthodoxie. Zugegeben: Sie schob jeglichem arminianischen Heilsverständnis einen Riegel vor. Wenn man den verschiedenen Ansichten der einzelnen Delegationen jedoch gehörige Aufmerksamkeit schenkt, wird man leicht erkennen: Die Synode bewies einen starken Grad an Flexibilität, selbst in Bezug auf Themen, die intensiv diskutiert wurden. Innerhalb der Grenzen der konfessionellen Orthodoxie ermöglichte Dordrecht einen gewissen Grad von Individualität und eine behutsam eingerichtete Ebene der Zusammenarbeit. Dieser Geist der dynamischen Orthodoxie ließ die Koexistenz von Supra- und Infralapsarismus in Dordrecht zu und sorgte für einen Geist der Vielfalt, wie er sich im Übrigen in späteren reformierten Bekenntnissen findet« (S. 123).
Jonathan D. Moore beschäftigt sich im Beitrag »The Extent of the Atonement« mit dem »hypothetischen Universalismus«. England erlebte bis in die 1640er Jahre keine bedeutende öffentliche Debatte über den Umfang der Sühne von Jesus Christus. Zwar herrschte kein breiter Konsens zugunsten der »begrenzten Sühne«, aber es bestand eine eher kirchenpolitische Übereinkunft: »Würde die vorherrschende, ›schwerere‹ Theologie zu schnell und zu öffentlich ›aufgeweicht‹, hätte das angesichts der wachsenden anti-reformierten Bedrängung die Stabilität des gesamten Bollwerks der reformierten Orthodoxie ins Wanken bringen können« (S. 157). Moore deutet die Entwicklung im England von Maria Stuart (1542–1587) als sanfte Aufweichung der reformierten Theologie, bei der unter anderem Richard Baxter eine bedeutende Rolle spielte. »Wir finden in ihm, der nach eigenem offenen Zugeständnis seine ursprünglich partikularistische Sichtweise zum Heil gemildert hatte, einen leitenden Förderer des hypothetischen Universalismus. Baxter schreibt, er habe sich ursprünglich ›gegen die universelle Sühne‹ starkgemacht, sei in seiner Ansicht jedoch aufgerüttelt worden, als er mit den Arminianern Tristram Diamond und Samuel Cradock zusammentraf. Schließlich gab er sein ›Vorurteil‹ auf, lehnte den eigentlichen Arminianismus jedoch weiterhin ab. Er räumte ein, dass ›Christus für alle gestorben ist, um Rechtfertigung und Heil zu erkaufen, das er jedem gibt, der glaubt‹« (S. 160). Der Trend zum behutsamen aber selbstbewussten »Abmildern älterer Formen reformierter Theologie kann in England unter den führenden Theologen durch das 17. Jahrhundert durchgängig nachgewiesen werden« (S. 160).
Das Westminster Glaubensbekenntnis von 1647 spricht in Artikel 7.2 von einem »Bund der Werke“, innerhalb dessen Adam und seinen Nachkommen »das Leben verheißen wurde« (vgl. auch im Großen u. Kleinen Westminster Katechismus Frage 20 bzw. 12). Aber was genau für ein Leben war Adam verheißen? Galt ihm die Verheißung eines ewigen und himmlischen Lebens, vorausgesetzt, er hätte Gottes Gebot erfüllt? Das war die Auffassung von Francis Turrentin und zahlreichen reformierten Theologen der damaligen Zeit. Andere Geistliche wie John Gill (1697–1771) oder Jonathan Edwards (1703–1758) deuteten die Verheißung irdisch. Mark A. Herzer zeichnet in seinem Aufsatz »Adam‘s Reward: Heaven or Earth« verschiedene Positionen über den Adam verheißenen Lohn nach. Einerseits gab es unterschiedliche Meinungen zum »Bund der Werke“, andererseits wurde nicht sonderlich »erhitzt« darüber debattiert. Die schließlich im Westminster Glaubensbekenntnis aufgenommene offene Formulierung ist eine Kompromisslösung, der alle Geistlichen der reformierten Orthodoxie zustimmen konnten.
Die reformierten Theologen Britanniens waren sich im 17. Jahrhundert uneins darin, wie der Alten Bund mit dem Gnadenbund in Beziehung zu setzen sei. Mit unterschiedlichen Sichtweisen zum Verhältnis von Gesetz und Evangelium beschäftigt sich Mark Jones (S. 183–203). Er kommt zu folgendem Ergebnis: »Versteht man den Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium als heilsgeschichtlichen Gegensatz zwischen dem Alten Bund (Gesetz) und dem Neuen Bund (Evangelium), dann nähern wir uns auch einem Verständnis der Diskussion zum Sinai. Die meisten reformierten Theologen (oft Presbyterianer) hoben die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Bündnissen hervor, doch einige bedeutende puritanische Denker (oft Kongregationalisten) wiesen rasch auf die Unterschiede hin. Für Männer wie Owen und Goodwin führte der Neue Bund zu einer großen, heilsgeschichtlichen Veränderung in der Art, wie Gott mit seinem Volk handelt. Dadurch wurde auch der Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium (AT/NT) deutlicher. Weitere Untersuchungen könnten zeigen, dass es in dieser Diskussion nicht nur um die Soteriologie geht, sondern auch um die Ekklesiologie, genauer: um die Art des Gottesdienstes im Neuen Bund im Gegensatz zur Praxis unter dem Alten Bund. Aus diesem Grund sollte der Gegensatz von Gesetz und Evangelium nicht primär unter soteriologischen Gesichtspunkten, sondern auch in ekklesiologischer Hinsicht untersucht werden. Diese Auseinandersetzung wird nicht alle Fragen beantworten, sollte jedoch in Betracht gezogen werden, wollen wir verstehen, weshalb die puritanischen Theologen über das exakte Verhältnis zwischen Altem und Neuem Bund uneins waren« (S. 202–203).
Carl Trueman geht in »The Necessity of the Atonement« (S. 204–222) der auch heute angesagten Frage nach: Musste Jesus Christus den Sühnetod sterben oder hätte Gott in einem Akt der Gnade den Menschen ihre Sünde einfach vergeben können? Konkret will der Kirchenhistoriker skizzieren, wie John Owen diese Fragestellung verarbeitet hat. Bei dem Puritaner ist eine Entwicklung nachweisbar. 1652 kam er zu der Überzeugung, dass ein »Verständnis der Sühne, das nicht auf der absoluten Notwendigkeit des Todes von Jesus Christus insistiert«, die Tür für Sichtweisen öffnet, »die dem Evangelium abträglich sind« (S. 204). Sünde müsse eher »von einem theozentrischen als einem anthropozentrischen Blickwinkel her verstanden werden« (S. 220). »Die Notwendigkeit des Opfers Christi beteuernd, präsentierte Owen eine reformierte Theologie, die die historische Person des Mittlers nicht aus dem Zentrum des Heilsdramas verdrängte. Es kann keine ewige Rechtfertigung geben, die einzig auf einem Beschluss beruht. Das Heil gründet genauso in der Geschichte wie in der Ewigkeit. Wer die Notwendigkeit der Fleischwerdung und der Sühne einzig auf dem göttlichen Ratschluss beruhen lassen wolle, läuft Gefahr, die historische Person Christi an den Rand zu drängen und die Wichtigkeit der Heilsgeschichte zu unterhöhlen« (S. 222).
Trueman plädiert in seinem bemerkenswerten Aufsatz außerdem dafür, den gern behaupteten Gegensatz von christozentrischer Theologie und reformierter Orthodoxie zu hinterfragen. »Während die ganze Einschätzung der reformierten Scholastik anhand theologischer Kriterien des 20. Jahrhunderts – seien sie neo-orthodox oder konservativ calvinistisch – höchst fragwürdig bleibt, so zeigt eine geschichtliche Analyse der relevanten Schriften: Viele der bevorzugten historiografischen Schibboleths der Neo-orthodoxie sind im Lichte der offenkundigen Beleglage unhaltbar. Owens Behandlung der göttlichen Gerechtigkeit ist ein gutes Beispiel. Hier macht sich ein Theologe der schlimmsten Sünden schuldig: positiver Gebrauch aristotelischer Kategorien, eine Neigung zu scholastischen Unterscheidungen und Argumentationsmethoden und – besonders schlimm – die Anlehnung an eine ›Entsprechung des Seins‹ [lat. analogia entis], für Barth ein Zeichen des Antichristen. Der herkömmlichen Überzeugung nach sollte das zu einer Theologie führen, die das christologische Herzstück des Christentums unterminiert und es mit einer menschenzentrierten Karikatur ersetzt. Tatsächlich entsteht dabei eine Theologie, die wenigstens in dieser Hinsicht wohl nicht weniger, sondern stärker christozentrisch ist, als die der Gegner Owens, einschließlich Calvin« (S. 221–222).
Richard J. McKelvey widmet seinen Aufsatz der Kontroverse um die sogenannte »ewige Rechtfertigung« (S. 223–262). Unter »ewiger Rechtfertigung« ist nach Francis Turrentin Justifikation als ein »in Gott selbst in Ewigkeit ausgeführter Akt« zu verstehen (S. 224). Gegner der »ewigen Rechtfertigung« meinen, Gott rechtfertige uns Menschen nicht vor, sondern in der Zeit. Während der Reformationszeit stand die Rechtfertigungslehre in voller Blüte. Bei dem damaligen Wandel verlagerte sich der Schwerpunkt der Rechtfertigung weg von der semi-pelagianischen Betonung des menschlichen Willens als eigentlichem Initiator. Das ermöglichte »das Aufkommen der Bündnistheologie; sie betonte das christozentrische und bündnishafte Wesen der Rechtfertigung. Der Akzent auf der absoluten Rechtfertigung aus freier Gnade beleuchtete auch die Wichtigkeit folgender Frage: Wie passt das Handeln des Menschen ins Schema? Eine Überbetonung des göttlichen Willens und der freien Gnade wirkte andererseits als Katalysator für den Antinomismus. Das Ungleichgewicht in Richtung Bedingtheit der Erlösung begünstigte den Arminianismus. Im nachreformatorischen England bekämpfte das Westminsterbekenntnis diese Gefahren und formulierte eine Theologie, die sowohl das göttliche wie auch das menschliche Handeln im Rahmen von Bündnissen betonte« (S. 259). McKelvey untersucht insbesondere, inwiefern die Rechtfertigung vor aller Zeit den Antinomismus stärken konnte. »Die Antinomisten machten sich die Sichtweise bereitwillig zu eigen, passte sie doch exakt zu ihrem Anliegen, jeglichen Gedanken menschlichen Zutuns zur Rechtfertigung auszulöschen. Gleichzeitig gehörte diese Lehre weder zu den Voraussetzungen des Antinomismus, noch war sie selbst spezifisch antinomistisch« (S. 262).
Joel R. Beeke erörtert im Beitrag »The Assurance Debate« (S. 263–283) die Behandlung der »Heilsgewissheit« bei den Puritanern. »Manche Puritaner verglichen die Heilsgewissheit mit der Meeresbrise, die gewöhnlich weht, wenn sie auch manchmal nur als schwaches Säuseln hörbar ist. Andere sprechen von der Heilsgewissheit als von einem mächtigen Wind, der ein schwer beladenes Segelschiff antreibt. Beide Seiten waren sich eins, dass der Geist weht, wo er will; wir können ihn weder begreifen noch fassen (Joh 3,8)« (S. 283). Jenseits der Unterschiede, die es bei den Puritanern in dieser Frage gab, finden sie in ihrer Hinwendung zu den Verheißungen der Schrift zusammen. Die Puritaner setzten in Bezug auf die Heilsgewissheit ganz auf das Vertrauen in das Wort und den Geist.
Der Baptismus spaltete sich in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in die sogenannten »General« und »Particular Baptists«. Während sich die »General Baptists« an einer arminianistischen Soteriologie orientierten, lehrten die anderen unter calvinistischem Einfluss, dass das Opfer Jesu Christi nur für die Erwählten gelte. Im letzten Aufsatz des Bandes erörtern Michael A.G. Haykin und C. Jeffrey Robinson die Diskussionen um das Abendmahl und die Kirchenlieder unter den »Particular Baptists« (S. 284–308). Besonders am Beispiel der Kirchenmusik wird deutlich, wie engstirnig manche Debatten vormals geführt wurden. Gestritten wurde nicht nur über die Rolle der Psalmen. Für Isaac Marlow war der gemeinsame Gesang insgesamt nicht schriftgemäß. Es solle, so Marlow, nur eine Stimme geben, kein gemeinsames Singen in der Versammlung (S. 300). Die Baptisten, die den gemeinsamen geistlichen Gesang praktizierten, setzten sich allerdings mittelfristig eindeutig durch. Ende des 17. Jahrhunderts wurde das Singen geistlicher Lieder unter den »Particular Baptists« zum allgemein anerkannten Teil des öffentlichen Gottesdienstes.
Drawn into Controversie bezeugt nüchtern, dass die puritanische Theologie des 17. Jahrhunderts viele Debatten und Spannungen auszuhalten hatte. Der Vorwurf, reformierte Theologie sei im 16. und 17. Jahrhundert überaus rigide aufgetreten, wird so eindrucksvoll relativiert. Gleichzeitig fällt auf, dass die Puritaner fortlaufend um theologische Einheit auf der Grundlage der Schrift gerungen haben und diese in den großen Bekenntnissen wie in dem von Westminster auch erlangt wurde. Herausgebern, Autoren und dem Verlag ist für die Veröffentlichung dieses ausgezeichneten Bandes zu danken.
– – –
Neben einem Inhaltsverzeichnis mit Einleitung gibt es hier die Rezension als PDF-Datei und eine Bestellmöglichkeit:

 Uwe Justus Wenzel stellt für die NZZ zwei Werke aus dem Lager des Neuen Atheismus vor. Die Sachbücher:
Uwe Justus Wenzel stellt für die NZZ zwei Werke aus dem Lager des Neuen Atheismus vor. Die Sachbücher: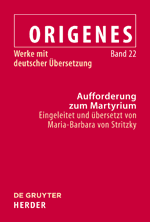 Rezension zum Buch:
Rezension zum Buch: Greg Gilbert setzt sich in seinem Buch Was ist das Evangelium? – der Titel lässt es vermuten –, mit der guten Nachricht von Jesus Christus auseinander. Geschrieben hat er darüber, weil unter Christen oft nicht ganz klar ist, worum es beim Evangelium geht. Einerseits fühlen sich viele überfordert, wenn sie zustimmend sagen sollen, was sie unter »Evangelium« verstehen. Andererseits gibt es heute allerlei Leute, die das Evangelium – meist sendungsbewusst auftretend – neu deuten. Für D.A. Carson ist diese Entwicklung »alarmierend, weil es um ein grundlegend wichtiges Thema geht. Wenn Evangelikale derart unvereinbare Ansichten darüber haben, »was das ›Evangelium‹ eigentlich ist, muss man die Schlussfolgerung ziehen, dass die evangelikale Bewegung ein facettenreiches Phänomen ist, ohne übereinstimmendes Evangelium«, schreibt er in seinem Vorwort.
Greg Gilbert setzt sich in seinem Buch Was ist das Evangelium? – der Titel lässt es vermuten –, mit der guten Nachricht von Jesus Christus auseinander. Geschrieben hat er darüber, weil unter Christen oft nicht ganz klar ist, worum es beim Evangelium geht. Einerseits fühlen sich viele überfordert, wenn sie zustimmend sagen sollen, was sie unter »Evangelium« verstehen. Andererseits gibt es heute allerlei Leute, die das Evangelium – meist sendungsbewusst auftretend – neu deuten. Für D.A. Carson ist diese Entwicklung »alarmierend, weil es um ein grundlegend wichtiges Thema geht. Wenn Evangelikale derart unvereinbare Ansichten darüber haben, »was das ›Evangelium‹ eigentlich ist, muss man die Schlussfolgerung ziehen, dass die evangelikale Bewegung ein facettenreiches Phänomen ist, ohne übereinstimmendes Evangelium«, schreibt er in seinem Vorwort. Beim Verlag Vandenhoeck & Ruprecht ist kürzlich das bemerkenswerte Buch:
Beim Verlag Vandenhoeck & Ruprecht ist kürzlich das bemerkenswerte Buch: Im Winter 2010 saß ich knapp zwei Stunden mit Anne Weiss im Café einer Berliner Jugendherberge, um über den christlichen Glauben zu sprechen. Gemeinsam mit Stefan Bonner stecke die Journalistin damals in den Vorarbeiten für ein neues Buch zum Thema »Wären wir ohne Religion besser dran?«. Das Gespräch war offen und nett, so wie auch der anschließende Austausch mit einigen Seminarteilnehmern beim Mittagessen. Der religionskritische Geist schwebte allerdings schon damals durch die Räume (vgl. die Mitteilung des Humanistischen Pressedienstes
Im Winter 2010 saß ich knapp zwei Stunden mit Anne Weiss im Café einer Berliner Jugendherberge, um über den christlichen Glauben zu sprechen. Gemeinsam mit Stefan Bonner stecke die Journalistin damals in den Vorarbeiten für ein neues Buch zum Thema »Wären wir ohne Religion besser dran?«. Das Gespräch war offen und nett, so wie auch der anschließende Austausch mit einigen Seminarteilnehmern beim Mittagessen. Der religionskritische Geist schwebte allerdings schon damals durch die Räume (vgl. die Mitteilung des Humanistischen Pressedienstes 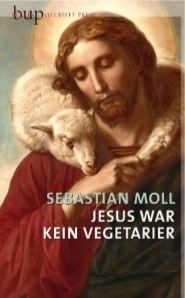 Die evangelische Theologie will vor allem politisch korrekt sein. Der Glaube stört da nur, behauptet der Nachwuchswissenschaftler Sebastian Moll in seiner Streitschrift:
Die evangelische Theologie will vor allem politisch korrekt sein. Der Glaube stört da nur, behauptet der Nachwuchswissenschaftler Sebastian Moll in seiner Streitschrift:


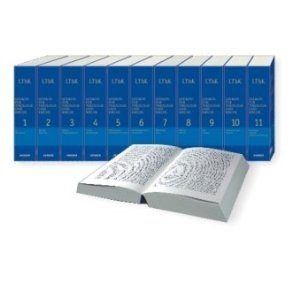 Das Nachschlagewerk Lexikon für Theologie und Kirche ist ein wichtiges Referenzwerk in Fragen der katholischen Theologie.
Das Nachschlagewerk Lexikon für Theologie und Kirche ist ein wichtiges Referenzwerk in Fragen der katholischen Theologie.