September 2015
John Owen als christlicher Psychologe
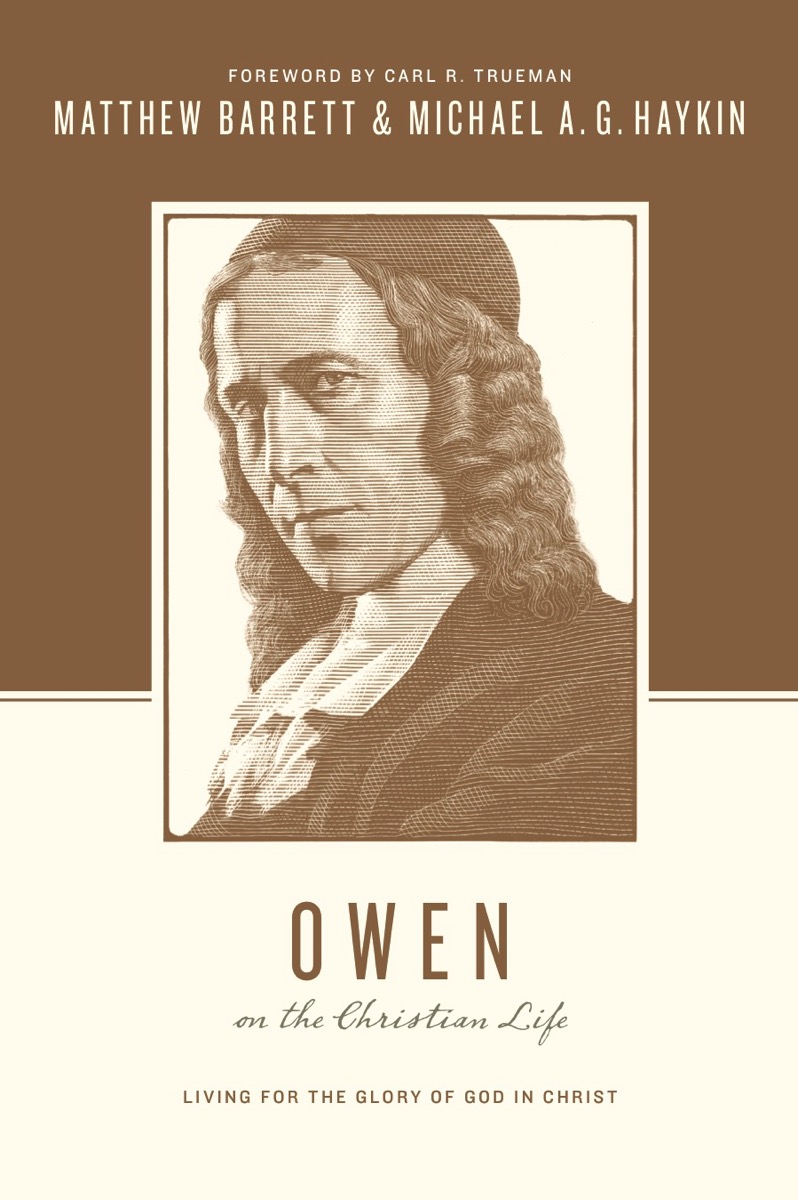 Carl R. Trueman schreibt in seinem Vorwort zur einem neuen Buch über John Owen:
Carl R. Trueman schreibt in seinem Vorwort zur einem neuen Buch über John Owen:
We live in an age when the challenges to Christianity, theological and practical (if one can separate such), are pressing in from all sides. Perhaps the most obvious challenge is the issue of homosexuality. Given the high pastoral stakes in this matter, it is important that we make the right decisions.What has this to do with the thought of a man who died nearly 350 years ago? Simply this: in our era much practical thinking is driven by emotions. Emotions are enemies of fine distinctions. And yet the ethical and practical issues facing the church today demand precisely such fine distinctions if we are to do our task as pastors and church members: comfort the brokenhearted and rebuke those at ease in their sin. And John Owen was of an era when fine distinctions were part of the very fabric of practical theology.
Like one of his great theological heroes, Augustine, Owen was an acute psychologist of the Christian life. Further, as part of the great post-Reformation elaboration and codification of Reformed orthodoxy, he was adept at careful distinctions and precise argument. Finally, as a pastor and preacher, he constantly brought these two things together in practical ways in his congregation. We might add that the pastoral problems in the seventeenth century—greed, sex, anxiety, marital strife, petty personal vendettas — have a remarkably familiar and contemporary feel.
Hier eine Leseprobe zu Owen on the Christian Life: -owen-on-the-christian-life.pdf.
Verfolgt in Deutschland
Leider sind besonders Christen in den europäischen Asylbewerberheimen Übergriffen durch fanatische Muslime ausgesetzt, berichtet Max Klingberg in einem Beitrag für DIE WELT. Für Konvertiten ist die Lage geradezu bedrohlich.
Ich arbeite seit über 10 Jahren mit Max Klingberg zusammen und schätze seine Expertise. Er gehört nicht zu den Krawallmachern, sondern setzt sich als Sachkundiger für Menschenrechtsfragen und Asylantenbetreuer für eine besonnene und selbstkritische Berichterstattung ein. Seine Beobachtungen sind durchaus ernst zu nehmen.
„Natürlich bringen Flüchtlinge auch ihre eigenen Konflikterfahrungen mit, zum Beispiel zwischen Schiiten und Sunniten oder Christen und Muslimen“, bestätigt der Migrationsforscher Klaus J. Bade. Er verlangt für die anstehenden Integrationsfragen gesellschaftspolitische Visionen und zukunftsorientierte Konzepte. Auch er fordert ein verstärktes Leitbild, mit dem sich die Deutschen, aber auch die Flüchtlinge identifizieren können – und müssen. „Das ist der Preis, den jeder Zuwanderer zahlen muss, der in Deutschland leben will.“ Bade fordert an den Integrationskurs angegliederte Orientierungshilfen, die zugeschnitten sind auf das jeweilige Herkunftsland.
„Häufig geht die Aggression von Afghanen oder Pakistanern aus, sie sind oft noch islamistischer als manche Syrer und Iraker“, sagt Max Klingberg von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, seit 15 Jahren in der Flüchtlingsbetreuung aktiv. Er geht davon aus, dass die Gewalt in den Asylunterkünften weiter ansteigen wird. „Wir müssen uns von der Illusion befreien, dass alle, die hier ankommen, Menschenrechtsaktivisten sind. Unter den jetzt Ankommenden ist ein nicht kleiner Anteil in ihrer religiösen Intensität mindestens auf dem Niveau der Muslimbrüder.“
Je enger die Menschen zusammenlebten, desto eher brächen Konflikte hervor. „Ehrenamtliche berichten von Aggressionen bis hin zu Enthauptungsdrohungen von Sunniten gegen Schiiten, doch am härtesten trifft es Jesiden und Christen“, sagt Klingberg. „Bei christlichen Konvertiten, die ihren Glauben nicht verheimlichen, geht die Wahrscheinlichkeit, Opfer von Übergriffen oder Mobbing zu werden, gegen 100 Prozent.“
Hier der Beitrag der Redakteurin Freia Peters: www.welt.de.
Versöhnung durch Sühne
In seiner Vorlesung zur Rechtfertigungslehre (aus: Dogmatik-Vorlesungen 1957–1960, Münster: Lit Verlag, 2013, S. 150–152) eröffnete Hans Joachim Iwand den Teil zur Versöhnungslehre mit einer religionsgeschichtlichen Darstellung. Deutlich wird dabei, dass er er den alttestamentlichen Kult als Erwartung und Vorbereitung des neutestamentlichen Sühnegeschehens deutete (vgl. Röm 3,24–26).
Wir gehen […] zunächst nicht vom biblischen Verständnis des Wortes [,Versöhnung1] aus, denn jene lexikographische Form, Theologie zu treiben, indem wir ein bestimmtes biblisches Verständnis des Wortes zum Ausgangspunkt nehmen, verliert nur allzu leicht den Sachbezug, in dem das Wort steht. Und die Schrift will ja nicht als eine Sammlung theologischer Worte und Begriffe gelesen sein, sondern als Zeugnis vom Handeln Gottes, wie es sterblichen und sündhaften Menschen widerfahren ist. So begegnet uns denn auch der Begriff ,Versöhnung’ im AT wie im NT im Zusammenhang mit Taten und Handlungen, sei es nun solchen Gottes mit uns oder solchen, die von Menschen her auf Gott hin vollzogen werden. Und wie immer man es auch fassen möge, ,versöhnen’ hat es im AT zunächst einmal mit Sühne zu tun. Es gilt, Gottes Zorn zu versöhnen, und so hat unser Wort seinen ureigensten Bereich in den Opferhandlungen, die sich in einem geregelten Kultus vollziehen. Man weiß eines, und man weiß das unter allen Völkern, dass es besonders bedrängende Lagen gibt, in denen es gilt, den Zorn Gottes zu beschwichtigen. Je kostbarer das Opfer ist, das der Mensch bringt, desto eher hofft er Gott zu besänftigen (placare, reconciliare). Wir werden gut daran tun, über diese in der gesamten Religionsgeschichte der Menschheit verbreitete Handlung des Sühnens ein wenig vorsichtiger zu urteilen, wenn wir erkennen, wie sehr diese Neigung in der menschlichen Natur verwurzelt ist: Man meint – und das eben ist die furchtbare und traurige Verfinsterung und Gottesfeme unseres Lebens -, dass es eine Wiedergutmachung1 Gott gegenüber gäbe, man meint, wir könnten etwas geben, um Gott umzustimmen. Dabei geben wir nun aber gerade , etwas’, also nicht uns selbst: nicht ein Ganzopfer des Menschenherzens, sondern etwas, das nicht wir sind! Und eben dies ist das Bedenkliche und Widergöttliche, daschen Religionen und Kulten vor, weshalb diese ja auch nicht irgendwelchen Phantasien entstammen, vielmehr einen sehr realen und oftmals erschütternden ernsten Akt im Handeln einer leidenden und gequälten Menschheit darstellen, die versucht, sich mit dem Himmel zu versöhnen. Es ist ein Wissen da um Schuld und die Meinung, dass Schuld und Strafe Zusammenhängen: von daher der Versuch der Menschen, der so alt ist wie sie selbst und den keine Aufklärung ihnen je wird ausreden können, die Götter zu versöhnen. Das ist die Wurzel aller Kulte.
In diesem Sinne haben auch der Kult und das Opfer seinen Platz im AT gefunden, und zwar so deutlich und so entschieden, dass hier als beherrschend heraustrat, was bei den Heiden sozusagen mehr an den Rand gedrängt war und nur hin und wieder aufbrach. Gerade jenes leidenschaftliche Bemühen, Gott zu versöhnen, beherrscht das Leben des alttestamentlichen Gottesvolks. Hier weiß man, dass die Sünde, damit dass sie getan ist, nicht hinter uns liegt, sondern dass sie weiterlebt, dass Gottes Arm noch ausgereckt ist, dass solche Menschentat damit, dass sie geschehen ist, eine Wirklichkeit wurde (etwa Kains Bluttat), die als solche nun auch die Wirklichkeit unseres Lebens gestaltet, und dass darum Gottes Grimm und Zorn über eben dieser Wirklichkeit steht. Es ist undenkbar, dass Gott auf die Sünde, die Übertretung seines Willens, nicht reagiert, undenkbar, dass er schwiege, wenn sein Name missbraucht, seine Anrufung unterlassen oder wenn er gar verraten wird, um anderen Göttern zu dienen.Es fallt auf, dass die Bibel unbedenklich vom Zorn Gottes redet, von seinen Gerichten und von seinem Grimm, beispielhaft im 1. Kapitel des Römerbriefs, in dem Paulus geradezu die Quintessenz der Zomesworte Gottes aus dem AT zusammengetragen hat. Dieser Zorn ist aber nichts anderes als das Verhalten Gottes zu der durch die Tat des Ungehorsams bestimmten Wirklichkeit des Menschen und der Welt. Wenn die Welt Gottes Welt ist, kann Gott neben sich und um sich nicht diese „Nichtigkeit“ [vgl. Röm 1, 21], diese auf den Nenner , Sünde4 zu bringende Größe dulden. Der Zorn Gottes ist Gottes Nein gegenüber der Zumutung, diese Wirklichkeit nun einfach auch als Wirklichkeit gelten zu lassen. Und selbst wenn wir Menschen sie gelten ließen – Gott kann und wird das nicht tun. Und eben das weiß in einer besonderen Weise, die nicht von den Tatsachen zur Ursache, sondern von der Ursache zur Tatsache geht, das AT: Es weiß, dass wir dahin müssen durch seinen Zorn [vgl. Ps. 90, 9], es weiß, dass die Gesetzgebung Leben und Tod bedeutet [vgl. Dtn 30] , es weiß, dass Gott in einem heiligen Volk leben will – und nur in ihm. Das ist die Größe des AT, dass es sich nicht begnügt mit der Harmonisierung und Versöhnung von Gott und Welt, sonderneben darin als widergöttlich erwiesen wurde, dass Gott das Werk der Versöhnung selbst übernommen hat. Der Sühne-Gedanke liegt in allen natürlichen Religionen und Kulten vor, weshalb diese ja auch nicht irgendwelchen Phantasien entstammen, vielmehr einen sehr realen und oftmals erschütternden ernsten Akt im Handeln einer leidenden und gequälten Menschheit darstellen, die versucht, sich mit dem Himmel zu versöhnen. Es ist ein Wissen da um Schuld und die Meinung, dass Schuld und Strafe Zusammenhängen: von daher der Versuch der Menschen, der so alt ist wie sie selbst und den keine Aufklärung ihnen je wird ausreden können, die Götter zu versöhnen. Das ist die Wurzel aller Kulte.In diesem Sinne haben auch der Kult und das Opfer seinen Platz im AT gefunden, und zwar so deutlich und so entschieden, dass hier als beherrschend heraustrat, was bei den Heiden sozusagen mehr an den Rand gedrängt war und nur hin und wieder aufbrach. Gerade jenes leidenschaftliche Bemühen, Gott zu versöhnen, beherrscht das Leben des alttestamentlichen Gottes-volks. Hier weiß man, dass die Sünde, damit dass sie getan ist, nicht hinter uns liegt, sondern dass sie weiterlebt, dass Gottes Arm noch ausgereckt ist, dass solche Menschentat damit, dass sie geschehen ist, eine Wirklichkeit wurde (etwa Kains Bluttat), die als solche nun auch die Wirklichkeit unseres Lebens gestaltet, und dass darum Gottes Grimm und Zorn über eben dieser Wirklichkeit steht. Es ist undenkbar, dass Gott auf die Sünde, die Übertretung seines Willens, nicht reagiert, undenkbar, dass er schwiege, wenn sein Name missbraucht, seine Anrufung unterlassen oder wenn er gar verraten wird, um anderen Göttern zu dienen.
Es fällt auf, dass die Bibel unbedenklich vom Zorn Gottes redet, von seinen Gerichten und von seinem Grimm, beispielhaft im 1. Kapitel des Römerbriefs, in dem Paulus geradezu die Quintessenz der Zomesworte Gottes aus dem AT zusammengetragen hat. Dieser Zorn ist aber nichts anderes als das Verhalten Gottes zu der durch die Tat des Ungehorsams bestimmten Wirklichkeit des Menschen und der Welt. Wenn die Welt Gottes Welt ist, kann Gott neben sich und um sich nicht diese „Nichtigkeit“ [vgl. Röm 1, 21], diese auf den Nenner ,Sünde‘ zu bringende Größe dulden. Der Zorn Gottes ist Gottes Nein gegenüber der Zumutung, diese Wirklichkeit nun einfach auch als Wirklichkeit gelten zu lassen. Und selbst wenn wir Menschen sie gelten ließen – Gott kann und wird das nicht tun. Und eben das weiß in einer besonderen Weise, die nicht von den Tatsachen zur Ursache, sondern von der Ursache zur Tatsache geht, das AT: Es weiß, dass wir dahin müssen durch seinen Zorn [vgl. Ps. 90, 9], es weiß, dass die Gesetzgebung Leben und Tod bedeutet [vgl. Dtn 30] , es weiß, dass Gott in einem heiligen Volk leben will – und nur in ihm. Das ist die Größe des AT, dass es sich nicht begnügt mit der Harmonisierung und Versöhnung von Gott und Welt, sondern dass es weiß und herausarbeitet, dass Gott selbst versöhnt sein muss und dass sein Zorn alles, selbst das erwählte Volk und selbst die Stätte seiner eigenen Anbetung nicht schont. Zorn Gottes heißt im AT: dass es kein Mittel gibt, um vor Gott zu bestehen, wenn er Sünden anrechnen will [vgl. Ps 130, 3], dass das Mittel, den Zorn zu wenden, allein in Gott selber liegt.
David Platt: Mission
Was denkst Du über Mission? Hier ist zu hören, was David Platt darüber zu sagen hat, leidenschaftlich, provokant, ernüchternd, persönlich:
Ist Theologie eine Wissenschaft?
Die Theologie hob seit dem 13. Jh. ihren Wissenschaftscharakter heraus, also seit der Zeit, in der die ersten Universitäten entstanden. In gewisser Weise genoss die Theologie innerhalb der Wissenschaft immer eine Sonderstellung, die sich allerdings im Verlauf der Geschichte umgekehrt hat. In der Scholastik und der frühen Neuzeit galt die Theologie als die führende und höchste Wissenschaft, als „Herrin“ und „Mutter“ aller anderen Wissenschaften, die ihrerseits zu „Mägden“ degradiert wurden. Das heißt: alle Künste und Wissenschaften mussten sich vor der Theologie (o. Kirche) rechtfertigen. Bis ins 18. Jahrhundert hinein war die Theologie dementsprechend geachtet. Mit der Aufklärung emanzipierten sich die anderen Wissenschaften jedoch von der Theologie und traten ihr gegenüber zunehmend selbstbewusst bis abfällig auf. Durchgesetzt hat sich ein Wissenschaftsverständnis, das ohne Gott auskommt. Da in den Wissenschaften so gearbeitet wird, als gäbe es keinen Gott, ist die „Hypothese Gott“ überflüssig geworden (Laplace).
Heute muss sich die Theologie gegenüber anderen Wissenschaften rechtfertigen. Wenn zum Beispiel die EKD die immerhin noch vom Staat finanzierten theologischen Fakultäten verteidigt, dann tut sie das, indem sie den Nutzen für die Gesellschaft herausstellt. Theologie als Wissenschaft korrigiere den ökonomischen Totalitarismus, leiste einen Beitrag zur Orientierungskraft von Religion und Weltanschauung, fördere die Toleranz; kurz: sie „ist für die Gesellschaft unentbehrlich“.
Das sehen ganz viele Leute anders. Sie stellen die Frage: Warum soll Theologie mehr sein als eine private Tröstung? Es gibt sehr unterschiedliche Strategien, um die bedrohte Wissenschaftlichkeit der Theologie zu rehabilitieren. Wir können uns nicht mit allen beschäftigen. Ich will nur versuchen, drei Strategien kurz zu skizzieren.
1 Der theonomistische Ansatz
Einmal gibt es Theologen oder Wissenschaftstheoretiker, die davon ausgehen, dass Gott die Voraussetzung für wissenschaftliches Arbeiten überhaupt ist. Wissenschaft kann es nur geben, weil Gott existiert und seiner Schöpfung eine rationale Struktur gegeben hat. Die Strömung, die auf den Apologeten Cornelius Van Til (1895–1987) vom Theologischen Seminar Westminster (USA, Philadelphia) zurückgeht, tritt mit dieser Denkvoraussetzung an. Zu ihren Vertretern gehören John Frame, Greg Bahnsen oder auch Vern Poythress. Poythress, der vor der Theologie Mathematik studiert und inzwischen sogar eine Logik verfasst hat, packt diesen Ansatz in den ersten Satz seiner Wissenschaftstheorie: „Alle Wissenschaftler, einschließlich der Agnostiker und Atheisten, glauben an Gott. Sie müssen das tun, um überhaupt ihre Arbeit tun zu können.“
John Frame hat ein Grundlagenwerk zur Erkenntnistheorie geschrieben, welches genau von dieser Denkvoraussetzung ausgeht. Er versucht in seinem Buch The Doctrine of the Knowledge of God eine christliche Erkenntnistheorie zu entwickeln, die sich einerseits durch ihren Bezug zu Heiligen Schrift auszeichnet und andererseits den nachmodernen Perspektivialismus würdigt (ja sogar biblisch begründet). Frame entwickelt ein durch und durch positives Verhältnis zur Wissenschaft, betrachtet ihre Disziplinen aber im Blick auf die Theologie eher als Hilfswissenschaften.
Er schreibt:
„Hier will ich allgemein zeigen, dass jede Wissenschaft so wie Linguistik, Logik und Geschichte uns dabei helfen kann, die Schrift zu interpretieren und anzuwenden. Es stimmt, dass viele Wissenschaften, vielleicht alle, heute von ungläubigen Denkvoraussetzungen dominiert werden und wir einen großen Aufwand betreiben müssen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber wenn wir unzweideutig auf dem biblischen Fundament arbeiten, können wir viel von der Wissenschaft lernen.“
Frame entwickelt im Folgenden einige Prinzipien zum Verhältnis von Theologie und Wissenschaft, die zeigen, dass er durchaus den Wissenschaften eigene Kompetenz zugesteht, aber alles in allem die Wissenschaften aus der Sicht der Schrift beleuchtet und beurteilt werden müssen. Er geht dabei davon aus, dass die Schrift sich bewährt, dass also das, was sie zu den Dingen sagt, die die Wissenschaft betreffen, autoritatives Wort Gottes ist.
Der theonomistische Ansatz zeichnet sich durch seinen Bibelbezug aus und hilft durchaus einem Christen beim Durchdenken seines Glaubens und auch dabei, den Glauben zur Welt der Wissenschaft in einen Bezug zu setzen. Seine Stärke liegt aber mehr in der Binnenkraft als in der Außenwirkung. Selten gelingt der Dialog mit den Wissenschaften, die unter den Bedingungen heutiger Wissenschaftstheorie arbeiten.
2 Der kritische Ansatz
Der kritische Ansatz zeigt dort, wo die Schwächen des theonomistischen Ansatzes liegen, seine Stärken. Theologen, die sich einem kritischen Ansatz verpflichtet fühlen, wollen die Theologie den aggressiven kritischen Rückfragen aus dem Raum der Wissenschaftstheorie bewusst aussetzen und Theologie unter den Bedingungen jeweils akzeptierter Wissenschaft treiben. Sie suchen also gezielt den Dialog mit der Wissenschaft. Dabei gehen sie davon aus, dass der christliche Glaube wirklichkeitsbezogen ist und sich auch vor dem Forum radikaler Anfragen bewähren kann.
Erkennbar sind die Ansätze dadurch, dass sie Theologie gegenüber einer jeweils prominenten Wissenschaftssicht verteidigen und daher die argumentativen Strukturen dieser „Paradigmen“ übernehmen.
Ein herausragendes Beispiel ist sicher Wolfhart Pannenberg (1928–2014), der das Problem erkannt hat und von der Theologie erwartet, dass sie sich so bewähren muss, wie andere Wissenschaften, „wenn auch zur theoretischen ‚Verifikation‘ der christlichen Lehre ihre affektive und praktische Bewährung hinzutreten muß“.
Ein anderer Theoretiker, der diese Herausforderung anzunehmen versucht, ist Richard Swinburne (geb. 1934), der von der analytischen Philosophie herkommend zeigt, dass der christliche Glaube plausibel ist. Swinburne nimmt die probabilistische Argumentation auf. Es ist wahrscheinlicher, dass es Gott gibt, als das es ihn nicht gibt. Er sagt über sein Buch zur Existenz Gottes:
„Die Schlußfolgerung dieses Buches ist, daß die Existenz, die Ordnung und die Feinabstimmung der Welt; die Existenz von bewußten Menschen in der Welt mit Möglichkeiten, sich selbst, einander und die Welt zu formen; eine Reihe historischer Indizien von Wundern im Zusammenhang mit menschlichen Nöten und Gebeten, besonders im Zusammenhang mit der Gründung des Christentums, weiter gestützt durch Erfahrungen seiner Gegenwart von Millionen von Menschen; daß all dies es erheblich wahrscheinlicher macht, daß es einen Gott gibt, als daß es keinen gibt.“
Im evangelikalen Raum hat sich in Deutschland vor allem Heinzpeter Hempelmann angestrengt, den Wirklichkeitsbezug des christlichen Glaubens hervorzuheben und zu zeigen, dass er sich nicht gegenüber Kritik immunisieren darf. Hempelmann setzt sich besonders mit den Vorwürfen des Kritischen Rationalismus auseinander, der insbesondere in der Person von Hans Albert dem Christentum unterstellt, es entziehe sich der kritischen Prüfung und die ganze Theologie sei damit unwissenschaftlich. Er kommt am Schluss seiner beachtlichen Dissertation zu dem Ergebnis:
„Der christliche Glaube lebt unter dem permanenten Gebot, sich einem offenen Dialog der Falsifizierbarkeit zu stellen. Nur so erreicht und demonstriert er seinen Wirklichkeitsbezug; nur so gewinnt er in der Bewährung die Glaubwürdigkeit, an der ihm im Interesse der von ihm vertretenen Botschaft doch sehr gelegen ein muß.“
Von katholischer Seite hat Helmut Peukert in der Auseinandersetzung mit der Kritischen Theorie (Jürgen Habermas) einen wissenschaftstheoretischen Ansatz, vorgelegt, der noch heute, vielleicht auch mangels Alternativen, große Wertschätzung genießt. Für Peukert ist Theologie „eine Theorie kommunikativen Handelns und der in diesem Handeln erschlossenen Wirklichkeit“.
Die Stärke des kritischen Ansatzes liegt in seiner Dialogfähigkeit. Theologie setzt sich der radikalen Kritik mit offenem Visier aus. Die Schwäche ist, dass durch die „Anpassungsleistungen“ meist Überzeugungen fallengelassen werden, die im Rahmen des Dialogparadigmas nicht „überlebensfähig“ sind. Sehr schön ist das beispielsweise bei Rudolf Bultmann zu sehen, der sich den Herausforderungen der Moderne mit bewundernswerter Konsequenz stellt, letztlich aber Glaubensinhalte geopfert hat, ohne die biblischer Glaube nicht auskommt (z. B. Auferstehung).
3 Der dialektische Ansatz
Einen vollkommen anderen Weg hat die sogenannte dialektische oder neo-orthodoxe Theologie um Karl Barth (1886–1968) eingeschlagen. Für Barth ist es eine Form des Götzendienstes, wenn Theologie sich einem heidnischen allgemeinen Wissenschaftsbegriff beugt. Wissenschaft muss für Barth zwar im Sinne der Sachgemäßheit wissenschaftlich sein. Gegenstand der Theologie ist aber Gott in seiner Offenbarung, also das Wort Gottes. Sachgemäßheit von Theologie entscheidet sich deshalb an der Frage, ob sie dem Wort Gottes entspricht oder nicht.
Barth warnt die Theologen davor, sich dem Druck wissenschaftlicher Forderungen zu stellen. Theologie muss sich nicht vor den heidnischen Künsten bewähren, sondern vor Gott. Es gibt – hier wird die Prägung durch Sören Kierkegaard erkennbar – keinen Übergang vom Wissen zum Glauben. Barth: „Direkt übernommen haben Philosophie, Geschichtswissenschaft, Psychologie usw. … faktisch noch nie etwas anderem als der Vermehrung der Selbstentfremdung der Kirche, der Entartung und Verwüstung ihrer Rede von Gott gedient.“
Das heißt für die Theologie:
„Keinesfalls folgt aus der Tatsache, daß sie als solche gilt und auch wohl zu gelten beansprucht, die Verpflichtung, sich mit Rücksicht auf das, was sonst ‚Wissenschaft‘ heißt, in ihrer eigenen Aufgabe stören und beeinträchtigen zu lassen. Der Ausrichtung auf diese ihre eigene Aufgabe hat sie vielmehr schlechterdings jede Rücksicht auf das, was sonst ‚Wissenschaft‘ heißt, unterzuordnen und nötigenfalls zu opfern. Die Existenz der anderen Wissenschaften, die höchst achtunggebietende Treue, mit der wenigstens manche von ihnen ihren Axiomen und Methoden nachgehen, kann und muß sie daran erinnern, daß auch sie ihrer eigenen Aufgabe ordentlich, d. h. mit entsprechender Treue nachgehen soll. Sie kann sich aber nicht von jenen darüber belehren lassen, was das in ihrem Fall konkret zu bedeuten hat. Sie hat methodisch nichts bei ihnen zu lernen. Sie hat sich nicht vor ihnen zu rechtfertigen, vor allem nicht dadurch, daß sie sich den Anforderungen eines zufällig oder nicht zufällig allgemein gültigen Wissenschaftsbegriffs unterzieht.“
Die Stärke dieses Ansatzes liegt sicher darin, dass Theologie ihren Gottesbezug wichtiger nimmt als alles andere. Theologie richtet sich nach ihrem Gegenstand, also an Gott und seiner Offenbarung, aus.
Aber es gibt eine entscheidende Schwäche. Nichts, was in der Welt passiert, kann den Glauben gefährden. Glaube hat sich gegenüber der Kritik immunisiert und muss sich den Vorwurf gefallen lassen, damit unwissenschaftlich zu sein.
Von allen drei Ansätzen oder Strategien können wir lernen. Denn ich glaube, (a) dass jeder Mensch um Gott weiß, dieses Wissen aber unterdrückt (theonomistischer Ansatz); dass (b) der Gottesglaube sich in der Wirklichkeit bewähren und deshalb auch gegenüber den Wissenschaften sprach- und argumentationsfähig sein muss (kritischer Ansatz); und schließlich (c) Theologie zuallererst von der Bezogenheit auf Gott und dem Gehorsam gegenüber Gottes Offenbarung bestimmt sein soll (offenbarungstheologischer Ansatz).
Kleines Wörterbuch des Gender-Wahnsinns
Mitarbeiter der DIE WELT-Redaktion haben sich die Mühe gemacht, das Statement der Fachschaftsinitiative Gender Studies der er Berliner Humboldt-Universität zu entschlüsseln. Ein Lehrstück! Die Erklärung der Fachschaft kann übrigens hier im PDF-Format geladen werden: statement-zum-ausschluss-von-r.pdf.
Ich empfehle den Ausflug in die hohe Wissenschaft der Gender Studies: www.welt.de.
Karl Barth über die Zukunft der Volkskirche
Zitiert aus: Georg Huntemann: Diese Kirche muss anders werden, Bad Liebenzell: VLM, 1979, S. 118:
Karl Barth bekannte sich 1956 in seinem „Brief an einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik“ zum Ende der Volkskirche „mit Kindertaufe, Konfirmation, Trauung und Beerdigung als die christliche Markierung des Rahmens und der Existenz des Herrn Jedermann, in deren Vollzug die Kirche sich in ihrer offenkundigen Unentbehrlichkeit immer wieder trösten möchte!“… „Ja, die Stunde könnte kommen oder schon anbrechen, wo Gott dieser ihrer Gestalt wegen ihrer immanenten greifbaren Unwahrhaftigkeit und Unfruchtbarkeit zu unserem Leidwesen, aber zu seiner Ehre und zum Heil der Menschen ein Ende machen will!“
Öffentliches Schweigen
Nachfolgend ein Buchhinweis aus Glauben & Denken heute 1/2015 zu:
- fuGE: Journal für Religion & Moderne, Bd. 14/15, 2014, Öffentliches Schweigen, hg. von Martin Knechtges u. Jörg Schenuit, Paderborn: Ferdinand Schöningh, 224 S. 24,90 Euro
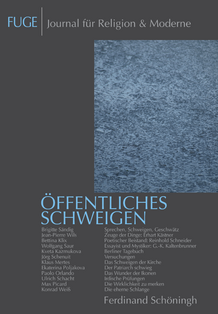 Auf meinen Lesestapel liegen hin und wieder Bände aus der katholischen Welt. Nicht nur, weil akademische Arbeit dies gebietet, auch Neugier und Staunen treiben mich an. Im vergangenen Jahr habe ich die Theologische Anthropologie (2011) von Thomas Pröpper und die Katholische Dogmatik (2005) von Gerhard Ludwig Müller studiert. Die Dogmatik ist didaktisch ausgesprochen klug aufbereitet. Pröpper hat mit seinem zweibändigen Werk einen eigenständigen Beitrag zur christlichen Anthropologie geliefert. Seine Darstellung des thomistisch-molinistischen Gnadenstreits (Bd. 2, S. 1351–1401) ist sehr zuträglich. Obwohl ich als reformierter Christ selbsterklärend viele Dinge anders sehe, erweitert die Lektüre meinen Horizont und hilft mir bei der „Versicherung“ meiner eigenen Glaubenspositionen, gerade auch im Blick auf die Gnadentheologie.
Auf meinen Lesestapel liegen hin und wieder Bände aus der katholischen Welt. Nicht nur, weil akademische Arbeit dies gebietet, auch Neugier und Staunen treiben mich an. Im vergangenen Jahr habe ich die Theologische Anthropologie (2011) von Thomas Pröpper und die Katholische Dogmatik (2005) von Gerhard Ludwig Müller studiert. Die Dogmatik ist didaktisch ausgesprochen klug aufbereitet. Pröpper hat mit seinem zweibändigen Werk einen eigenständigen Beitrag zur christlichen Anthropologie geliefert. Seine Darstellung des thomistisch-molinistischen Gnadenstreits (Bd. 2, S. 1351–1401) ist sehr zuträglich. Obwohl ich als reformierter Christ selbsterklärend viele Dinge anders sehe, erweitert die Lektüre meinen Horizont und hilft mir bei der „Versicherung“ meiner eigenen Glaubenspositionen, gerade auch im Blick auf die Gnadentheologie.
Nicht nur hochtheologische Bücher liegen auf dem Stapel, Zeitschriften und Periodika gehören auch dazu. Zum Beispiel die FUGE, ein Journal für Religion & Moderne, das von Martin Knechtges und Jörg Schenuit im Verlag Ferdinand Schöningh herausgegeben wird. In einer Zeit, in der im öffentlichen Raum fast nur noch Marktschreier gehört werden, setzt die FUGE auf die Wahrung von Stille und Andacht. Tatsächlich erlebe ich beim Stöbern in der FUGE „Entschleunigungsmomente“. Das Journal „zwingt mich“, langsam und aufmerksam zu lesen. Wohltuend.
Der Doppelband 14/15 steht unter dem Thema „Öffentliches Schweigen“. Die 224 Seiten enthalten viele nennenswerte Beiträge. Ich will drei erwähnen.
Die Literaturwissenschaftlerin und Philosophin Ekaterina Poljakova erörtert in ihrem Aufsatz zur Klerikalismuskritik Charles Taylors aus dem Jahr 1960 das Thema soziale Gerechtigkeit auf einem Niveau, das ich andernorts vermisse. Anstatt uns, so ihr Vorwurf, mit dem Gerechtigkeitsanspruch der Bibel auseinanderzusetzen, orientieren wir uns allzu oft an den Reichtumside-alen der westlichen Zivilisationen. Aber ist der irdische Wohlstand ein christliches Ziel? „Hier bitte ich die Leser, einen Moment inne zu halten, bevor sie sich empören. Auch mir gefällt die schreiende Ungerechtigkeit ‚dort draußen‘ nicht. Aber zwischen einem ‚mir gefällt es nicht‘ und ‚Gott gefällt es nicht‘ könnte, so möchte ich zu bedenken geben, auch in diesem schwierigen Fall durchaus ein Unterschied in re bestehen. (Schon sprachlich deutet sich dies ja an: Das Wort ‚Gerechtigkeit‘ ist im Deutschen leicht irreführend, entsprechen ihm in der Bibel doch verschiedene Wörter. Die irdische Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit Gottes jedenfalls werden unterschiedlich bezeichnet, und schon dies sollte uns zur Vorsicht mahnen.) Meine provokante Frage möchte ich nun also in der Sache noch einmal formulieren. Wenn ich es für mich selbst für gut halte, arm zu sein und in Christi Namen verfolgt zu werden – also meine Haltung ganz nach dem klaren Wort des Herrn ‚Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein‘ (Mt 5,12) ausrichte, und wenn ich diese Freude als etwas Heiliges, als etwa Erwünschtes ansehe, warum sollte ich meinem Nächsten nicht dasselbe wünschen, will ich ihn doch lieben wie mich selbst? In jedem Fall scheinen Zweifel angebracht, ob die christliche Liebe wirklich ganz selbstverständlich darin bestehen sollte, Arme reich zu machen oder allen Menschen Wohlstand und ein möglichst langes Leben zu sichern“ (S. 105).
Berührt hat mich Brigitte Sändigs Essay „Sprechen, Schweigen und Geschwätz“. Die Literaturwissenschaftlerin schreibt über ihre Erfahrungen in der ehemaligen DDR und entwickelt eine kleine „Phänomenologie des Geschwätzes“. Eindrucksvoll deckt sie auf, dass die „Freisetzung des Sprechens“ nach dem Fall der Mauer nicht nur das ehrliche Gespräch, sondern auch das „taktische, verbrämte, vorgegebene Sprechen“ (S. 14) wiedergebracht hat. Das aufrichtige Wort, das in der DDR im nichtöffentlichen Raum immerhin eine Möglichkeit war und hin und wieder spürbaren Tiefgang erreicht hat, ist in der freien Welt vom Regime manipulativer Sprachregelungen eingefangen worden. Sändig zitiert das Bologna-Schwarzbuch (Bonn, 2009): „Systemische Unterdrückung der Freiheit beginnt in der Regel mit Eingriffen in die Sprache. Mittels Sprachregelung versucht man das Denken der Menschen schleichend zu manipulieren …“ Weiter schreibt sie: „Zur Manipulation gehört etwa die ständige Wiederholung absichtsvoll geschaffener Begriffe, die dadurch in den Status des Selbstverständlichen erhoben werden und sich unversehens in den allgemeinen Sprachgebrauch einschleichen“ (S. 15).
Höhepunkt ist für mich der Beitrag über Reinhold Schneider von Bettina Klix. Schneider war ein katholischer Schriftsteller, der sich von Anfang an mit der Diktatur des Nationalsozialismus auseinandersetzte und gegen Unterdrückung, Rassenwahn und Volksverherrlichung anschrieb. Mit seinem Werk Las Casas vor Karl V. Szenen aus d. Konquistadorenzeit (1938) stellte sich Schneider mitten in der NS-Zeit gegen die Judenverfolgung. Einer Anklage wegen Hochverrat konnte Schneider entkommen, da 1945 das „Großreich“ zusammenbrach und es nicht mehr zur Verhandlung kam. Bettina Klix beschreibt in Skizzen das Leben und Werk Schneiders und würdigt seine Arbeiten besonders, indem sie erzählt, wie er ihr in Tagen eigener Beunruhigung ein aufrichtender Begleiter geworden ist. Als sich die Schriftstellerin intensiv mit dem Schrecken des Konzentrationslagers Bergen-Belsen auseinandersetzte und angesichts der geschilderten Gräueltaten fast verzweifelt ist, waren es Schriften Schneiders, die sie aufgerichtet haben. „Gemäß dem biblischen Wort, dass nur die Wahrheit uns freimachen kann, stellt Schneider fest: ‚Der neue Glaube aber, den Ereignisse von unverwindlicher Furchtbarkeit von uns fordern, ist der Einbruch der Wahrheit in unser Leben‘“ (S. 35).
Ist jeder Christ ein Theologe?
Wir sind wahrscheinlich damit vertraut, dass es im Raum unserer Gemeinden und Kirchen unterschiedliche Auffassungen über den Nutzen der Theologie gibt. Auf der einen Seite des Spektrums haben wir Leute, die überhaupt nicht wiedergeboren sind, aber Theologie studieren. Sie treten mit dem Anspruch auf, dass nur ein studierter Theologe das Recht habe, theologische Aussagen zu machen. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es Christen, die die Theologie für ein Werk des Teufels halten. Sie treten in der Regel sendungsbewusst auf und sind sich – so jedenfalls meine Erfahrung – sehr sicher, dass die Beschäftigung mit der Theologie in den allermeisten Fällen den persönlichen Glauben und die Lehre in der Gemeinde beschädigt.
Diese unterschiedlichen Auffassungen über den Nutzen der Theologie lassen sich teilweise dadurch erklären, dass diese Gruppen unter Theologie jeweils etwas anderes verstehen. Die studierten Theologen haben die akademische Theologie im Kopf, die Gegner der theologischen Arbeit verbinden mit der Theologie eher liberale Strömungen, haben jedoch eine hohe Meinung von der biblischen Lehre.
Tatsächlich ist es allerdings so, dass jeder Christ in einem gewissen Sinn ein Theologe ist. Es geht gar nicht um die Frage, ob jemand theologische Überzeugungen hat, sondern vielmehr darum, was für theologische Überzeugungen ein Mensch hat. Entweder ist unsere Theologie gut, das heißt schrifttreu. Oder sie ist schlecht, was bedeutet, dass sie Dinge vernachlässigt, die in der Heiligen Schrift offenbart sind, etwas überbetont oder über Dinge hinausgeht, die in der Schrift stehen (oder unsauber darstellt). Insofern ist in einem gewissen Sinne bereits das Kind in der Sonntagsschule ein „Doktor der Theologie“.
Zugleich müssen wir allerdings feststellen, dass es unterschiedliche Personenkreise oder „Maße“ für die Theologie gibt.
Wir haben (1) eine Theologie für alle Jünger, also eine Laientheologie. Ich gebrauche dieses Wort keinesfalls abwertend, sondern gemäß dem Anliegen des allgemeinen Priestertums. Für diejenigen, die glauben, gilt (1Petr 2,9–10):
„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr seid die, die einst kein Volk waren, jetzt aber das Volk Gottes sind, die einst keine Barmherzigkeit erlangten, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt haben.“
Ein Christ ist von Gott dazu auserwählt, die Wohltaten seines Herrn „auszurufen“, „zu verkünden“ oder „zu proklamieren“ (griech. ἐξαγγέλλω). Dieser Verkündigungsdienst setzt natürlich voraus, dass die Priester mit dem Evangelium vertraut sind. Gläubige des Neuen Bundes haben nicht nur Gemeinschaft miteinander und feiern das Herrenmahl, sie halten fest an der „Lehre der Apostel“ (Apg 2,42). Christen waren einst Sklaven der Sünde, sind aber jetzt von ganzem Herzen „gehorsam geworden der Gestalt der Lehre“ oder der „Wahrheit“, die ihnen durch die Apostel übergeben wurde (Röm 6,17; 1Petr 1,21).
In diesem Sinne ist jeder Christ Priester und insofern ebenfalls Theologe. Er nimmt das Wort Gottes bereitwillig auf und forscht – wenn möglich täglich –, ob das, was er glaubt, mit der Schrift übereinstimmt (vgl. Apg 17,11). Er verkündigt das Wort sich selbst, aber auch seinen Kindern, geistlichen Geschwistern oder Ungläubigen.
Wir haben (2) eine Theologie für die Diener der Gemeinden. Obwohl alle Christen zur königlichen Priesterschaft gehören, sind einige von ihnen mit Aufgaben betraut, die eine besondere theologische Kompetenz erfordern. Ich denke hierbei nicht an die Lehrer und Hirten, sondern an Mitarbeiter, deren Aufgaben bereits ein tieferes Verständnis für die „göttlichen Dinge“ voraussetzen.
In der Apostelgeschichte wird uns davon berichtet, dass die Apostel nicht mehr genug Zeit für das Wort Gottes und das Gebet hatten, da zu viele praktische Tätigkeiten zu verrichten waren (vgl. Apg 6,1–4). Um diesen Umstand zu ändern, wurden Diakone eingeführt, die die Apostel in ihrem geistlichen Dienst entlasten sollten. Obwohl sich die Diakone vor allem um leibliche Bedürfnisse und praktische Aufgaben kümmerten, achtete die Gemeinde in Jerusalem darauf, dass diese Männer stark im Glauben und vom Heiligen Geist erfüllt waren.
Es trifft zu, dass von den Diakonen im Unterschied zu den Ältesten keine Lehrfähigkeit erwartet wird (s. 1Tim 3,8–13). Dennoch sollen sie das „Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren“ (1Tim 3,9). Den Ausdruck „Geheimnis des Glaubens“ verwendet der Apostel Paulus anderswo zur Bezeichnung des offenbarten Evangeliums (vgl. 1Kor 2,7ff.; Eph 3,3–9; 1Tim 3,16). Gemeint ist also, dass sie das Evangelium verstanden haben, ihm vertrauen und in Übereinstimmung mit ihm leben.Bei unterschiedlichsten Diensten in den Gemeinden wird mehr erwartet als ein persönlicher Glaube und charakterliche Festigkeit. Ich denke da an Christen, die Gottesdienst leiten, die Kinder schulen oder Hauskreise führen. Solche Mitarbeiter sollten gründlich in der biblischen Lehre geschult sein.
Wir haben (3) eine Theologie für Hirten, Verkündiger und Lehrer der Gemeinden. Wer in der Gemeinde öffentlich unterrichtet, braucht die „Fähigkeit zu lehren“ (vgl. 1Tim 3,2). Von ihm darf erwartet werden, dass er „sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen“ (Tit 1,9).
Schließlich haben wir (4) eine Theologie für die Lehrer zukünftiger Lehrer. Wir können das einem Rat entnehmen, den Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus weitergibt (2Tim 2,2):
„Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren.“
Ich möchte an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Aber sicher ahnen wir, was gemeint ist: Es gibt erfahrene, begabte und hoffentlich bewährte Lehrer, die bei der Zurüstung zukünftiger Lehrer und Prediger helfen.
Es geht hier freilich nicht um unterschiedliche Theologien für unterschiedliche Kreise, sondern um unterschiedliche Maße der Gottesgelehrtheit mit der einen Lehre des Christus. Von Lehrern wird ein höheres Maß der Gottesgelehrtheit erwartet als von Diakonen, die beispielsweise für die Gemeindefinanzen zuständig sind. Obwohl alle Christen in einem Sinne Priester sind, sind nicht alle Lehrer (1Kor 12,29; Eph 4,11).
Noch etwas: Wem Gott viel anvertraut, von dem wird er auch viel erwarten (vgl. Lk 12,48). Einem Menschen, dem viel anvertraut wurde, der aber andere zur Sünde verführt, erwartet am Tag des Gerichts eine sehr harte Strafe. Jesus sagt in Mt 18,6:
„Wer aber einen dieser Geringen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es gut, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde.“
Hirten, Pastoren und Lehrer haben deshalb eine besonders große Verantwortung. Deshalb warnt Jakobus (Jak 3,1): „Es sollen nicht viele von euch Lehrer werden, meine Brüder! Denn ihr wisst, dass wir als solche ein noch strengeres Urteil empfangen werden“ (vgl. a. 2Kor 11,15). Wer andere Christen durch falsche Lehren verwirrt, „wird das Urteil tragen, wer er auch sei“ (Gal 5,10).

