Hanniel hat zwei Bücher über bzw. von J.I. Packer besprochen. Ein Buch ist schon recht alt, dass andere Buch von Sam Storms ist frisch auf dem Markt und heißt: Packer on the Christian Life: Knowing God in Christ, Walking by the Spirit (Crossway, 2015). Hier:
Das Leseerlebnis
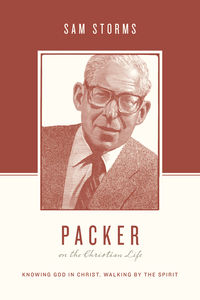 J. I. Packer gilt als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des Evangelikalismus der letzten 100 Jahre. Dabei muss man sich keinen „Grandseigneur“ vorstellen, sondern einen „bescheidenen, demütigen christlichen Gentleman“ (so die Beschreibung des Kirchenhistorikers Carl R. Trueman). Packer ist zur der Erscheinung dieses Buches gegen 90 Jahre alt und noch immer aktiv.
J. I. Packer gilt als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des Evangelikalismus der letzten 100 Jahre. Dabei muss man sich keinen „Grandseigneur“ vorstellen, sondern einen „bescheidenen, demütigen christlichen Gentleman“ (so die Beschreibung des Kirchenhistorikers Carl R. Trueman). Packer ist zur der Erscheinung dieses Buches gegen 90 Jahre alt und noch immer aktiv.
Packers Prosa ist so flüssig und klar formuliert, dass Sams Storms zögerte, diese zu umschreiben. Packer kommt in diesem Buch ausführlich zu Wort. Die längeren Zitate bereichern den Text ungemein. Sie stärken zudem das Anliegen des Autors, den Leser zu den Originalen hinzuführen. In meinem Fall ist ihm dies gelungen. Es liegen bereits einige Bände auf meinem Nachttisch.
Die inhaltliche Führung
Der Gedankenfluss des Buches ist angenehm, gerade angesichts der inhaltlichen Breite und Fülle des Materials. Es beginnt mit einer kurzen biografischen Einführung und startet dann mit dem zentralen Gedanken von Packers Werk: Dem stellvertretenden Sühnetod von Jesus Christus. „Christi versöhnendes Opfer ist Grundlage und Quelle von allem anderen, das in der christlichen Erfahrung folgt.“ (24) Was folgt, wird in zehn Teilen à 12 – 15 Seiten entfaltet: Die Rolle der Heiligen Schrift, die Bedeutung von Heiligkeit sowie Inhalte und Mittel der Heiligung, ergänzt mit einem eigenen Kapitel zur Auslegung von Römer 7,14-25. Dann folgen Kapitel über die Rolle des Heiligen Geistes, die Notwendigkeit des Gebets, das Erkennen von Gottes Willen und die Unvermeidbarkeit von Leid. Storms lässt das Buch mit dem Zentralgedanken „Gott erkennen“ und dem Zielkompass, gut zu enden, ausklingen.
Was heraussticht
Durchs Band sticht J. I. Packers Liebe zur Schrift heraus. Es gibt kein christliches Leben ohne die offenbarte Wahrheit des Wortes Gottes (46). Dabei geht es um propositionelle, für den (erleuchteten) Verstand erkennbare Inhalte. Zweitens wiegt sein scharfes Unterscheidungsvermögen, das ihn zielsicher einfache Modelle entwerfen lässt, so z. B. zu den drei Zugängen zur Schrift (Subjektivisten, Traditionalisten und Objektivisten) oder zur Typologisierung der Evangelikalen (Aktivisten, Intellektualisten und Abweichler).
Packer gelingt es ausgewogen zu bleiben. Dies kommt beispielsweise in seiner Einschätzung der charismatischen Bewegung schön zur Geltung. Er scheut sich nicht, auch heisse Eisen mit klaren Worten anzupacken – etwa die umstrittene Auslegung von Römer 7.
Zwei Beispiele: Anwendung von Gottes Wort und Facetten des Gebets
Zwei konkrete Beispiele: Erstens seine fünffache Anwendung von Gottes Wort im christlichen Leben (61). Wenn die darin offenbarten Prinzipien Wahrheit sind, was folgt daraus?
- Anwendung auf den Verstand: Welche Gedankengänge, –gewohnheiten und -gebäude werden gefördert und welche herausgefordert?
- Anwendung auf den Willen: Welche konkreten Handlungen und welche Typen von tugendhaftem Verhalten sollen folgen?
- Anwendung auf die Gefühle („affections“): Was wird gelehrt, was wir lieben, worauf wir hoffen oder darauf bestehen, in denen wir uns freuen sollen?
- Anwendung auf die Motivation: Was ermutigt uns, der Gerechtigkeit nachzustreben und in ihr auszuharren?
- Anwendung auf die Selbsterkenntnis und die Selbstprüfung: Wie kommen wir diesen Anforderungen zur Zeit nach? Wo kommen wir zu kurz?
Zweites Beispiel: Packer stellt die verschiedenen Facetten des Gebets wundervoll dar (139ff): Gebet nimmt die Form des Anliegens (petition), der Konversation (durch Gottes offenbarten Willen in der Bibel), der Meditation (als aktive mentale Übung des Nachdenkens über die Schrift, Gott, die Schönheit der Schöpfung und die Wahrheiten der Erlösung), von Lob, Selbstprüfung und Klage an.
Fazit
Mich liess das Buch mit dem Verlangen zurück, in der Heiligung zu wachsen. Am meisten ermutigt wurde ich durch den „erfrischenden und hoffnungsvollen Realismus“ (133). Sein Werk ist ein wirksames Gegenmittel gegen den gesellschaftlichen Imperativ des selbst-zentrierten Lebens. Gott und seine Herrlichkeit haben Vorrang. Und: Theologie und geistliches Leben gehören unbedingt zusammen (29).
An zweiter Stelle hat Storms die Liebe Packers zur Heiligen Schrift herausgehoben. Als Beispiel dafür, wie Packer sein Anliegen treu vertrat, sei als eine Art „Anhang“ das 1958 erschienene Buch „Fundamentalism and the Word of God“ kurz dargestellt.
Zum Hintergrund des Buches
 Als das Buch erschien, war Packer war also 32-jährig. Der Inhalt muss auf dem Hintergrund der Fundamentalismus-Debatte der 50er-Jahre innerhalb Grossbritanniens bedacht werden. „Fundamentalismus“ war noch nicht Sammelbegriff angesichts globaler Herausforderungen wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Packer bezog ihn ausschliesslich auf den „evangelikalen“ Teil der Kirche Englands, der damit „etikettiert“ worden war. Er trägt im ersten Kapitel eine Reihe offizieller Definitionen des Begriffs vor. Genau an dieser Stelle beginnt die inhaltliche Auseinandersetzung: Um drehte sich die Kontroverse? Was war der theologische Kern?
Als das Buch erschien, war Packer war also 32-jährig. Der Inhalt muss auf dem Hintergrund der Fundamentalismus-Debatte der 50er-Jahre innerhalb Grossbritanniens bedacht werden. „Fundamentalismus“ war noch nicht Sammelbegriff angesichts globaler Herausforderungen wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Packer bezog ihn ausschliesslich auf den „evangelikalen“ Teil der Kirche Englands, der damit „etikettiert“ worden war. Er trägt im ersten Kapitel eine Reihe offizieller Definitionen des Begriffs vor. Genau an dieser Stelle beginnt die inhaltliche Auseinandersetzung: Um drehte sich die Kontroverse? Was war der theologische Kern?
Der inhaltliche Kern: Die Frage nach der Autorität
Theologisch liberale Vertreter warfen den Evangelikalen Bibliolatrie (Götzendienst an der Bibel) und Pseudowissenschaftlichkeit vor (99-100; Kindle-Positionen). Diese und andere Vorwürfe verdunkelten jedoch die eigentliche Fragestellung. Es ging um die Frage nach Autorität. Die einen sahen Lehrmeinungen als Facetten und Fragmente der göttlichen Wahrheit an, welche einander ergänzten; die anderen betrachteten es als unabdingbar, sämtliche Ansichten anhand der biblischen Autorität zu beurteilen. Packer stellt sich hinter letztere Gruppe: „Unsere erste Aufgabe muss darin bestehen, menschliche Worte durch das autoritative Wort Gottes zu messen.“ (184-185)
Der Autor sieht eine zweifache Aufgabe, die er in diesem Werk zu erledigen gedachte: Erstens galt es zu klären, was mit dem (unglücklichen) Begriff ‚Fundamentalismus‘ gemeint war, nämlich die Fortsetzung des jahrhundertealten evangelischen (engl. ‚evangelical‘) Glaubens. „Die Kritiker bezeichnen sie als neue Häresie. Wir nennen Gründe, ebendiese als älteste Orthodoxie zu betrachten.“ (231) Zweitens war es unabdingbar, die Frage nach der höchsten Autorität sauber zu klären.
Die vier inhaltlichen Hauptschritte
Nach der Definition des Problems wird die Antwort in vier Schritten skizziert: Schrift – Glaube – Verstand – Liberalismus. Die Schrift muss die Methoden und Voraussetzungen, mit welcher sie studiert wird, bestimmen (920). Der Gott geschenkte Glaube führt zu einem durch den Heiligen Geist erleuchteten Verstand. Dieser vertraut sich den propositionellen Aussagen von Gottes Wort als oberster Instanz an. Von dort aus entfaltet er einen grossen Eifer, mit allen geschenkten Fähigkeiten – gerade auch dem Verstand – das Offenbarte zu erkennen. Er verweigert sich niemals historischem Studium oder genauer Exegese.
Zur Aktualität der Debatte
Der theologische Liberalismus versuchte, das Christentum mit den Leitsätzen des Anti-Supernaturalismus in Einklang zu bringen. In der Folge musste sich der Evangelikalismus den Vorwurf gefallen lassen, zu vielen Bereichen des modernen Lebens sprachlos geworden, ja sich kulturell abgekapselt zu haben.
Weshalb ist das Buch so aktuell? Auch heute lassen Pragmatismus und eine ausgeprägte Denkfeindlichkeit eine ungeschützte Flanke im Evangelikalismus offen. Gleichzeitig hat der Virus des theologischen Liberalismus zahlreiche Gemeinden zu befallen begonnen. (Angehende) Pastoren müssen deshalb bei der Schriftfrage dringend mit einer solch klar formulierten und argumentativ wasserdichten Abhandlung vertraut gemacht werden.
Angesichts des weit verbreiteten ethischen Relativismus, der auch die Evangelikalen erfasst hat („das ist deine Interpretation, ich habe meine“), tut es also Not, uns den Fragen dieses Buches zu stellen. Packer tat dies vor 50 Jahren nicht als erster; er beruft sich ausdrücklich auf B. B. Warfield (1851-1921) und Gresham Machen (1881-1937). Diese Vordenker hatten die Unterschiede zwischen dem Christentum und dem (theologischen) Liberalismus bereits deutlich herausgearbeitet: Es sind zwei unterschiedliche Religionen. Unsere Aufgabe besteht darin, den christlichen Glauben verständlich in unserer Zeit zu verkündigen, niemals aber (spät)modernes Gedankengut christlich zu verpacken (1905)! Um eines vom anderen zu unterscheiden, müssen wir – zur Schrift gehen.
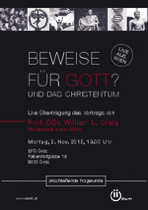

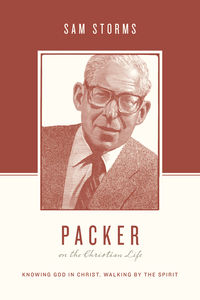 J. I. Packer gilt als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des Evangelikalismus der letzten 100 Jahre. Dabei muss man sich keinen „Grandseigneur“ vorstellen, sondern einen „bescheidenen, demütigen christlichen Gentleman“ (so die Beschreibung des Kirchenhistorikers Carl R. Trueman). Packer ist zur der Erscheinung dieses Buches gegen 90 Jahre alt und noch immer aktiv.
J. I. Packer gilt als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des Evangelikalismus der letzten 100 Jahre. Dabei muss man sich keinen „Grandseigneur“ vorstellen, sondern einen „bescheidenen, demütigen christlichen Gentleman“ (so die Beschreibung des Kirchenhistorikers Carl R. Trueman). Packer ist zur der Erscheinung dieses Buches gegen 90 Jahre alt und noch immer aktiv. Als das Buch erschien, war Packer war also 32-jährig. Der Inhalt muss auf dem Hintergrund der Fundamentalismus-Debatte der 50er-Jahre innerhalb Grossbritanniens bedacht werden. „Fundamentalismus“ war noch nicht Sammelbegriff angesichts globaler Herausforderungen wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Packer bezog ihn ausschliesslich auf den „evangelikalen“ Teil der Kirche Englands, der damit „etikettiert“ worden war. Er trägt im ersten Kapitel eine Reihe offizieller Definitionen des Begriffs vor. Genau an dieser Stelle beginnt die inhaltliche Auseinandersetzung: Um drehte sich die Kontroverse? Was war der theologische Kern?
Als das Buch erschien, war Packer war also 32-jährig. Der Inhalt muss auf dem Hintergrund der Fundamentalismus-Debatte der 50er-Jahre innerhalb Grossbritanniens bedacht werden. „Fundamentalismus“ war noch nicht Sammelbegriff angesichts globaler Herausforderungen wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Packer bezog ihn ausschliesslich auf den „evangelikalen“ Teil der Kirche Englands, der damit „etikettiert“ worden war. Er trägt im ersten Kapitel eine Reihe offizieller Definitionen des Begriffs vor. Genau an dieser Stelle beginnt die inhaltliche Auseinandersetzung: Um drehte sich die Kontroverse? Was war der theologische Kern?