Sylvia Löhrmann (Grüne), Schulministerin in NRW, will noch mehr Bildung. Die Halbtagsschule alter Prägung – so gab sie bekannt – lehne ihre Partei ab. Sie will den Ganztag „weiter ausbauen, denn dadurch kann individuelleres Lernen viel besser gestaltet werden“. Die Schule müsse dringend stärker an die Befindlichkeiten der Kinder angepasst werden. „Kinder sollen im Mittelpunkt stehen, nicht das System“, erklärte Löhrmann während ihres Interviews mit der Tageszeitung DIE WELT.
Ich kann Schulministerin Löhrmann nur empfehlen, sich an der progressiven Bildungsinitiative in den USA zu orientieren. Wie heute bekannt wurde, soll der Bildungsstandard „Common Core“ in Zukunft Gefühle als Lösungen für mathematische Aufgaben akzeptieren. Ein leitender Mitarbeiter von „Common Core“ erklärte gegenüber Journalisten:
Jede Emotion, jedes Gefühl, jede Aussage oder jeder Slogan wird im Neuen Mathematik-Standard als akzeptable Lösung für fast alle Aufgaben anerkannt werden. Was wir als Lehrer von den Schülern erwarten, ist, dass sie aufrichtig, echt, authentisch und sich selbst treu bleiben, wenn sie die Aufgabe lösen.
Die vollständige Pressemitteilung ist bei The Babylon Bee zu lesen: babylonbee.com.
Achtung: Satire!
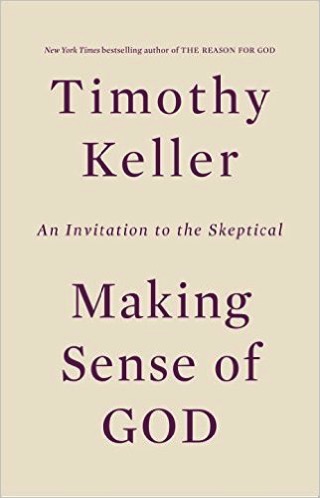 In dem Buch Making Sense of God:
In dem Buch Making Sense of God:  Dass ein katholischer Theologe Βegründungsversuche einer forensischen Rechtfertigungslehre mit größter Skepsis wahrnimmt, ist verständlich. Aber diese Kritik an N.T. Wrights groß angelegtem Unternehmen, die Lehre der Glaubensrechtfertigung in seinem Paul and the Faithfulness of God (PFG) bundestheologisch zu verankern, hat es in sich. Gregory Tatum resümiert:
Dass ein katholischer Theologe Βegründungsversuche einer forensischen Rechtfertigungslehre mit größter Skepsis wahrnimmt, ist verständlich. Aber diese Kritik an N.T. Wrights groß angelegtem Unternehmen, die Lehre der Glaubensrechtfertigung in seinem Paul and the Faithfulness of God (PFG) bundestheologisch zu verankern, hat es in sich. Gregory Tatum resümiert: