Zur Glaubwürdigkeit der biblischen Texte
Ich habe im Netz sein Manuskript Digging for Evidence von Peter S. Williams gefunden. Das kann hier legal heruntergeladen werden: digging_for_evidence.pdf.
Ich habe im Netz sein Manuskript Digging for Evidence von Peter S. Williams gefunden. Das kann hier legal heruntergeladen werden: digging_for_evidence.pdf.
Empirischen Daten, Umfragen, Netzwerke und Statistiken treiben heute die Wissenschaft und Politik vor sich her. Das Rezept für erfolgreiches Forschen lautet: „Man nehme zentrale ‚qualitätstragende‘ Schlag- und Signalwörter in ausreichender Menge, verwende reichlich einschlägige Messwertangaben in Abbildungen und Tabellen und garniere das Ganze mit vielversprechenden Zitationen und internationalen Kooperationen“. Das meinen jedenfalls die Pädagogen Katja Koch und Stephan Ellinger, die derzeit für viel Aufruhr sorgen. Sie haben so etwas wie die deutsche „Sokal-Affäre“ angestoßen.
Der Physiker Alan Sokal sorgte 1996 für einen Skandal, indem er in einer angesehenen Fachzeitschrift eine Parodie auf das postmoderne Denken publizierte. In seinem anspruchsvollen Aufsatz „Die Grenzen überschreiten: Auf dem Weg zu einer transformativen Hermeneutik der Quantengravitation“ übertrug er typisch postmoderne Denkweisen auf die Naturwissenschaften. Auf diese Weise erweckte er den Eindruck, dass auch in den harten Wissenschaften nicht Tatsachen und Beweise, sondern subjektive Interessen und Perspektiven zählen. Der Beitrag, der vom intellektuellen Establishment dankbar aufgenommen wurde, war freilich eine Aneinanderreihung von barem Unsinn (siehe meine Schilderung hier).
Einen ähnlichen „Fake“ produzierten Koch und Ellinger kürzlich in der Zeitschrift für Heilpädagogik (11/2016). Dort stellten sie die Behauptung auf, durch ein evidenzbasiertes Förderprogramm mit dem Titel „Kuno bleibt am Ball (KUBA)“ könnten die individuellen Folgen sozialer Übervorteilung bei Kindern nachhaltig abgeschwächt werden.
Nicht nur den Namen des Programms haben sie frei erfunden. Ähnlich wie bei Sokal ist der gesamte Aufsatz eine Zusammenfügung unsinniger Floskeln. Durch Signalwörter, Messwertangaben und Querverweise wurde der Unfug clever getarnt. Die Autoren wollten so den Nachweis erbringen, dass in der pädagogischen Fachwelt die absurdesten Thesen durchgehen, wenn der Sprachduktus passt.
Die Sonderpädagogen erklärten ihr Experiment später mit den Worten:
„Nun ist nicht weiter verwunderlich, wenn niemand bemerkt, dass statistische Kennwerte frei erfunden und Effektstärken nur ausgedacht sind. Solange die Zahlen plausibel sind, kann man das auch gar nicht bemerken. Offenkundig aber ist, und genau darum ging es uns, dass der vorgelegten Empirie eine schlüssige theoretische Grundannahme fehlt. Wir wollen auf die Tendenz hinweisen, dass immer häufiger nicht mehr die Plausibilität einer Theorie oder Logik eines Arguments, sondern einzig die Überzeugungskraft der dargestellten Daten, Zahlen und Forschungsmethoden über die Diskussionswürdigkeit eines Beitrages entscheidet. Wir sehen Anlass zur Sorge, dass durch die Dominanz ‚evidenzbasierter‘ Ausrichtung innerhalb der Sonderpädagogik ernsthafte pädagogische Überlegungen zu drängenden Fragestellungen und offene Diskussionen bald gänzlich verdrängt werden.“
Kurz: Mit Berechnungen lässt sich viel illustrieren, erklären und begründen. Die Frage ist: Stimmen die Grundannahmen, auf denen die Kalküle beruhen?
Der Aufsatz brachte Heiterkeit und große Empörung. Sogar die Schlichtungsstellen der Universitäten Rostock und Würzburg sind angerufen worden.
Der SPD-Politiker Mathias Brodkorb hat erfreulicherweise in der FAZ Stephan Ellinger und Katja Koch jetzt ehrwürdig verteidigt. Spitz bemerkt der Finanzminister Mecklenburg-Vorpommerns: „Während noch vor zwanzig Jahren in den Geisteswissenschaften das postmoderne Kauderwelsch hoch im Kurs stand, sind es im Zeitalter der empirischen Bildungsforschung Zahlen, Tabellen und stochastisches Vokabular“ (FAZ vom 01.12.2017, Nr. 27, S. N4).
Brodkorb geht noch weiter und stellt drei Thesen auf, die es in sich haben:
So kann es weiter gehen!
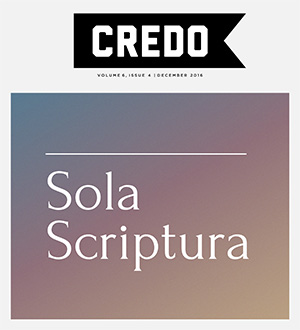 Die neue Ausgabe des Magazins Credo hat wieder einmal hervorragende Beiträge zu bieten. Hauptsächlich beschäftigt sich die Dezemberausgabe mit dem Thema „allein die Schrift“. Gavin Ortlund schreibt über das „Sola Scriptura damals und heute“ und der vielleicht derzeit profilierteste Lutheraner aus Nordamerika, Robert Kolb, spricht über „Martin Luther und das Wort Gottes“. Kurz vorgestellt werden bedeutende protestantische Lehrbücher, z.B. die Institutio (1559) von Calvin und die Institutio theologiae elencticae (1696) von Francis Turretin oder die Reformierte Dogmatik von Herman Bavinck (ab 1895).
Die neue Ausgabe des Magazins Credo hat wieder einmal hervorragende Beiträge zu bieten. Hauptsächlich beschäftigt sich die Dezemberausgabe mit dem Thema „allein die Schrift“. Gavin Ortlund schreibt über das „Sola Scriptura damals und heute“ und der vielleicht derzeit profilierteste Lutheraner aus Nordamerika, Robert Kolb, spricht über „Martin Luther und das Wort Gottes“. Kurz vorgestellt werden bedeutende protestantische Lehrbücher, z.B. die Institutio (1559) von Calvin und die Institutio theologiae elencticae (1696) von Francis Turretin oder die Reformierte Dogmatik von Herman Bavinck (ab 1895).
Sehr gefreut habe ich mich über ein Interview mit Professor Paul House über Bonhoeffers Sicht auf das theologische Studium. Zwei Zitate:
Bonhoeffer wanted to help students do the following: learn to read the Bible and to pray, which their university studies had not taught them; learn to live in community with other pastors as brothers rather than as competitors; learn to live alone in communion with God while serving, not dominating, God’s people. He believed that spiritual discipline and academic excellence in community were necessary for these traits to develop.
…
Studying Bonhoeffer has helped me recommit to following Jesus whatever the concrete cost may turn out to be, to make hearing God in his Word a chief daily priority, to persevere in slow, careful formative work, to refuse to separate intellectual and spiritual formation, and to stress the value of face-to-face ministry with students and colleagues.
Die Ausgabe kann hier heruntergeladen werden: Sola%20scriptura.pdf.
 Bisher habe ich keine so gute Einführung in die „Philosophie“ von L’Abri gehört wie die von Dick Keyes. Keyes sprach 1984 auf einer Konferenz in Knoxville (USA) über fünf Hauptideen der von Francis und Edith Schaeffer gegründeten Studiengemeinschaft. Diejenigen, die die Theologie des Niederländers Abraham Kuyper schätzen, werden sofort wissen, um was es geht. Für andere wird allerlei befremdlich klingen.
Bisher habe ich keine so gute Einführung in die „Philosophie“ von L’Abri gehört wie die von Dick Keyes. Keyes sprach 1984 auf einer Konferenz in Knoxville (USA) über fünf Hauptideen der von Francis und Edith Schaeffer gegründeten Studiengemeinschaft. Diejenigen, die die Theologie des Niederländers Abraham Kuyper schätzen, werden sofort wissen, um was es geht. Für andere wird allerlei befremdlich klingen.
Ich selbst habe 1982 angefangen, Bücher von Francis Schaeffer zu lesen. Damals haben sie mir geholfen, mein Denken erneuern zu lassen und mein Christusvertrauen zu festigen. Wenn ich nun, 35 Jahre später, diesen Vortrag höre, denke ich: Wir brauchen diese Sichtweisen mehr als wir sie schon damals brauchten (den Vortrag sollte m.E. jemand transkribieren und übersetzen). Hören wir mal auf ein Zitat von Schaeffer aus dem Jahr 1968 (Gott ist keine Illusion, 1974 (1968), S. 8):
Die Tragik unserer heutigen Situation liegt darin, dass die neue Einstellung zur Wahrheit Männer und Frauen in ihren Lebensgrundlagen erschüttert hat, ohne dass sie sich jemals Rechenschaft über den neuen Kurs gegeben haben. Die jungen Menschen werden zunächst im Rahmen des alten Wahrheitsverständnisses erzogen. Dann geraten sie unter den Einfluss der modernen Auffassung. Mit der Zeit werden sie unsicher, weil sie die ihnen vorgelegte Alternative nicht durchschauen. Diese Unsicherheit führt zu Verwirrung und bald zu einem inneren Zerbruch — unglücklicherweise nicht nur bei jungen Menschen, sondern auch bei vielen Pfarrern, Lehrern, Evangelisten und Missionaren.
Wie aktuell! Ich möchte hinzufügen: Wir sind inzwischen viel weiter. Etliche Leute, die ich treffe, haben das „alte Wahrheitsverständnis“ gar nicht mehr kennengelernt.
Eine Einführung in den Ansatz von L’Abri gibt es auf Deutsch in dem Buch Wahrheit und Liebe (besonders die Aufsätze „L’Abri – wie bitte?“ von Rüdiger Sumann und „Den Glauben verständlich machen in einer nichtchristlichen Gesellschaft“ von Dick Keyes).
Hier die fünf Hauptideen, die Dick Keyes erklärt:
Und hier der Vortragsmitschnitt (vielen Dank an Soundword):
Das MEDIENMAGAZIN PRO berichtet darüber, wie sich Jessica Brautzsch den christlichen Glauben angeschaut, Gottesdienste besucht und sich mit Jesus und der Bibel auseinandergesetzt hat. Im August 2016 hat sich die MDR-Journalistin schließlich taufen lassen. In einem crossmedialen Projekt des MDR zeichnet sie ihren Weg zum Glauben nach.
Nun, es lassen sich da Dinge hören und finden, die noch nicht ganz ausgereift und abgeklärt sind. Aber insgesamt ist das sehenswert und macht neugierig: reportage.mdr.de.
Gerhard Ebeling schreibt in Anlehnung an Luther über den christlichen Sündenbegriff (Dogmatik des christlichen Glaubens, Bd. 1, 1979, S. 365):
„Wie man die Sünde als ein Nichtwollen, daß Gott Gott sei, charakterisieren kann, so will auch der Sünder nicht, daß er Sünder sei, wie er gleichfalls nicht will, daß er Geschöpf sei. Der Sünder will also die Sünde nicht wahrhaben.
Im Grundgesetz heißt es (Art. 5):
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
Mit neuen Gesetzen will die Bundesregierung nun allerdings Internet und soziale Medien bändigen. Lästige Kritik im Netz soll verstummen. China oder die Türkei sind hier Vorbilder.
Justizminister Heiko Maas will, dass der Staat über „falsch“ und „richtig“ entscheiden lässt.
Roland Tichy schreibt dazu:
Am deutlichsten wird der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Grosse-Brömer. In der Sendung „Berlin Direkt“ erklärte er die Notwendigkeit staatlicher Aufsicht über Onlinegespräche. „Im Netz sind ’ne Menge Leute unterwegs, die destabilisieren wollen, die falsche Meinungen verbreiten, die manipulieren wollen, und da muss Politik mit umgehen, insbesondere vor Wahlkämpfen.“
Die falsche Meinung zu Wahlkampfzeiten – übrigens ist dieses Interview in der ZDF-Mediathek nur ohne diese verräterische Stelle abrufbar – Grosse-Brömer will statt „Meinungen“ „Meldungen“ gemeint haben. Konzedieren wir ihm das. Es läuft jedenfalls.
Aber wer entscheidet über „falsche“ und „richtige“ Meldungen? Etwa das „Abwehrzentrum gegen Desinformation“? Der „Spiegel“ berichtet, dass es ausgerechnet im Bundespresseamt eingerichtet werden soll.
Soll das Sprachrohr der Bundesregierung zu einem „Wahrheitsministerium“ aufgebaut werden? Ein Begriff, den George Orwell für seine düstere Vision der Totalüberwachung im Roman „1984“ prägte. Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, und deshalb wohl wird ein drohender Krieg mit Russland aus der Mottenkiste geholt.
Selbstverständlich ist Kommunikation schon länger grenzüberschreitend. Der Fall des Sowjetimperiums fällt zusammen mit Fernsehprogrammen aus dem Westen, die per Satellit auch in die letzten Winkel den Traum von Wohlstand und Freiheit transportieren. Der Krieg im Äther gehörte zum Alltag im Kalten Krieg – Deutsche Qelle sowie RIAS (Rundfunk im Amerikanischen Sektor) strahlten gezielt in die DDR und Radio Free Europe nach Osteuropa; übrigens noch heute in 28 Sprachen. Die DDR funkte zurück – mit „Stimme der DDR“ und mächtigen Störsendern, die die Westwellen in Verwirrung bringen sollten.
Jetzt wird im Internet ein neuer Ätherkrieg ausgerufen, dem sich alle, die guten Willens sind, anschließen.
Wie kürzlich dokumentiert, gibt es bereits Forderungen, für bestimmte Leute das Internet zu sperren. Georg Orwells 1984 soll sich, so habe ich kürzlich irgendwo gelesen, zur Zeit ganz hervorragend verkaufen.
Lesenswert: www.tichyseinblick.de.
Was rechtfertigt den Glauben an einen Gott? Haben wir aus philosophischer, naturwissenschaftlicher und moralischer Sicht Gott noch nötig? Prof. Dr. Harald Seubert hat bei den „Fabrikdialogen“ einen Vortrag über die Gottesfrage gehalten:
VD: SD
 Tim Keller, Hauptpastor der Redeemer Presbyterian Church in Manhattan (USA), hat über drei Gefahren des geistlichen Dienstes gesprochen. Stefan Beyer hat freundlicherweise die Hauptgedanken in deutscher Sprache zusammengestellt:
Tim Keller, Hauptpastor der Redeemer Presbyterian Church in Manhattan (USA), hat über drei Gefahren des geistlichen Dienstes gesprochen. Stefan Beyer hat freundlicherweise die Hauptgedanken in deutscher Sprache zusammengestellt:
Hier der vollständige Vortrag:
Hanniel hat sich Bibeln und christliche Medien für Kinder genauer angeschaut und dabei festgestellt, dass sich neben einer übertriebenen Visualisierung eine verniedlichende Sprache breit gemacht hat.
Leider folgen viele Medien für Kinder – neben den Kinderbibeln sind insbesondere die Hörspiele und die Lieder zu nennen – dem Trend der Säkularisierung. Biblische Begriffe werden vermieden. Das heisst, sie werden gar nicht mehr genannt oder mit anderen, allgemeinen ersetzt. Statt „Jesus“ steht dann einfach „Gott“. Nun wissen wir, dass dieser Begriff sehr beliebig geworden ist. Unter „Gott“ ist fast jede menschliche Vorstellung zu fassen. „Sünde“ wird ebenfalls nicht mehr genannt, sondern allenfalls „Fehler“ (also etwas, das zwar auf der horizontalen Ebene Nachteile bringt, aber immer korrigierbar bleibt). Statt „Gemeinschaft“ wird die „Freundschaft“ – der Kreis der bevorzugten Ansprechpartner anstelle der korrigierenden und schützenden Familie und Kirchgemeinde – stark betont. Die Liebe als unbedingte Zuwendung egal von der Vorgeschichte wird sehr betont (er will dich; er nimmt dich an, wie du bist) zulasten der Heiligkeit (Gerechtigkeit, Reinheit). Die Erfahrung eines zukünftigen Gerichts verschwindet ebenfalls. Stattdessen wird über die unmittelbaren Konsequenzen gelehrt (warum jemand nicht lügen soll). Ein Gott, der dich will, dir gute Freunde schenkt, der immer online ist und bei dem auch Ausrutscher problemlos durchgehen: Das ist grob gesagt das „fromme“, von der Säkularisierung eingefärbte Bild.
Mehr: hanniel.ch.