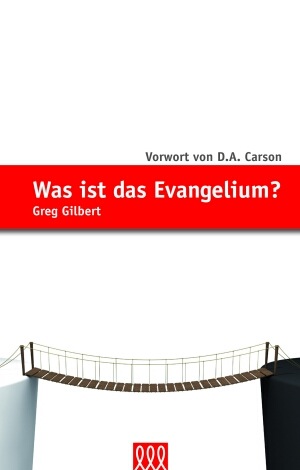 Greg Gilbert setzt sich in seinem Buch Was ist das Evangelium? – der Titel lässt es vermuten –, mit der guten Nachricht von Jesus Christus auseinander. Geschrieben hat er darüber, weil unter Christen oft nicht ganz klar ist, worum es beim Evangelium geht. Einerseits fühlen sich viele überfordert, wenn sie zustimmend sagen sollen, was sie unter »Evangelium« verstehen. Andererseits gibt es heute allerlei Leute, die das Evangelium – meist sendungsbewusst auftretend – neu deuten. Für D.A. Carson ist diese Entwicklung »alarmierend, weil es um ein grundlegend wichtiges Thema geht. Wenn Evangelikale derart unvereinbare Ansichten darüber haben, »was das ›Evangelium‹ eigentlich ist, muss man die Schlussfolgerung ziehen, dass die evangelikale Bewegung ein facettenreiches Phänomen ist, ohne übereinstimmendes Evangelium«, schreibt er in seinem Vorwort.
Greg Gilbert setzt sich in seinem Buch Was ist das Evangelium? – der Titel lässt es vermuten –, mit der guten Nachricht von Jesus Christus auseinander. Geschrieben hat er darüber, weil unter Christen oft nicht ganz klar ist, worum es beim Evangelium geht. Einerseits fühlen sich viele überfordert, wenn sie zustimmend sagen sollen, was sie unter »Evangelium« verstehen. Andererseits gibt es heute allerlei Leute, die das Evangelium – meist sendungsbewusst auftretend – neu deuten. Für D.A. Carson ist diese Entwicklung »alarmierend, weil es um ein grundlegend wichtiges Thema geht. Wenn Evangelikale derart unvereinbare Ansichten darüber haben, »was das ›Evangelium‹ eigentlich ist, muss man die Schlussfolgerung ziehen, dass die evangelikale Bewegung ein facettenreiches Phänomen ist, ohne übereinstimmendes Evangelium«, schreibt er in seinem Vorwort.
Im hinteren Teil seines Buch befasst sich Gilbert mit einigen problematischen Interpretationen des Evangeliums. Er spricht dabei auch das Konzept der »Gesellschaftlichen Transformation« an, das sich heute großer Beliebtheit erfreut.
Mir selbst waren besonders Anfang der 90er Jahre, inspiriert von Abraham Kuyper, »Kulturrelevanz« und »Gesellschaftstransformation« sehr wichtig. Ich hatte große Bauchschmerzen im Blick auf die unter Evangelikalen verbreitete Rückzugsmentalität. Es erschien mir als unverantwortliche Verkürzung, Evangelium auf die Frage des Heils zu reduzieren. Und ich bedauerte die Neigung, alles »Nichtfromme« anderen zu überlassen.
Viel Verständnis habe ich damals (in Deutschland) nicht geerntet. Derzeit läge ich allerdings ganz im Trend, »Gesellschaftstransformation« ist der große Renner. Obwohl ich meine Position nicht grundsätzlich geändert habe, trete ich im Blick auf eine anzustrebende Transformation der Gesellschaft heute deutlich bescheidener auf als vor 20 Jahren. Oft ist die »Transformative Theologie« auf ein naïves Kulturkonzept und eine gute Portion Populismus angewiesen (siehe auch das Interview mit J.D. Hunter). Und: Ich habe in den vergangenen 20 Jahren etliche Christen, Familien und Gemeinden »von Innen« kennenlernen dürfen (mich selbst eingeschlossen). Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob wir der Welt viel schenken können. Vor den Evangelikalen braucht man keine Angst haben, zuviel erwarten sollte die Welt von ihnen aber auch nicht. Kurz: Mir ist inzwischen das Christuszeugnis wichtiger geworden. Das, was wir der Welt zu geben haben, bleibt – sagen wir – übersichtlich. Deshalb sollten Christen der Welt nicht zu viel versprechen, sondern Zeugnis ablegen von einem andern: »Denn nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns selbst aber als eure Knechte, um Jesu willen« (2Kor 4,5).
Gilberts Erörterung der Transformativen Theologie finde ich fair und angemessen. Hier der entscheidende Abschnitt (136–138):
Der Gedanke, die Gesellschaft müsse durch die Arbeit von Christen sichtbar verändert werden, scheint in letzter Zeit von vielen Evangelikalen Besitz ergriffen zu haben. Ich halte das für ein lobenswertes Ziel und ich glaube auch, dass die Bemühung, sich dem – persönlichen oder system-immanenten – Bösen in der Gesellschaft entgegenzustellen, biblisch ist. Paulus sagt uns, wir sollen allen Menschen Gutes tun, »besonders aber … den Hausgenossen des Glaubens« (Gal 6,10). Jesus trägt uns auf, für unseren Nächsten zu sorgen, wozu auch Außenstehende gehören (s. Lk 10,25–37). Und er sagt ebenfalls: »So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen« (Mt 5,16).
Viele »Transformationalisten«‚ gehen aber noch weiter und behaupten, der Auftrag, »die Gesellschaft zu erlösen«, sei tief in die Aussagen der Bibel eingewoben. Wenn Gott tatsächlich die Welt neu erschaffen will, argumentieren sie, dann liegt es in unserer Verantwortung, uns an dieser Arbeit zu beteiligen. Wir sollten »Baumaterial« für das Königreich sammeln und deutliche Schritte auf die Aufrichtung von Gottes Herrschaft in unserer Nachbarschaft, in unseren Städten und Ländern und in unserer Welt hin tun. »Wir müssen tun, was wir Gott tun sehen«, sagen sie.
Darf ich ganz offen sagen, was ich darüber denke? Ich habe ernste biblische und theologische Vorbehalte gegenüber dem Transformations-Paradigma. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Heilige Schrift den Bemühungen um gesellschaftliche Veränderung den gleichen Stellenwert beimisst, den viele »Transformationalisten« fordern. Das hat mehrere Gründe. Einerseits denke ich nicht, dass das kulturell-gesellschaftliche Mandat im Buch Genesis dem Volk Gottes als solches gegeben ist; ich meine, es ist der ganzen Menschheit gegeben. Zweitens denke ich nicht, dass die menschliche Gesellschaft – weder in der Bibel noch in der Geschichte – sich generell auf Gott zubewegt. Ich bin vielmehr der Ansicht, die menschliche Kultur bzw. Gesellschaft als Ganzes (wenn auch nicht in jedem Einzelfall) bewegt sich auf das Gericht zu (s. Offb 17–19). Daher halte ich den Optimismus vieler »Transformationalisten«, sie könnten »die Welt verändern«, für irreführend und somit letztendlich entmutigend.
Hinter all dem steckt allerdings eine enorme biblisch-theologische Diskussion, die hier nicht mein Hauptanliegen ist. Ich bin der Ansicht, es ist möglich, ein engagierter »Transformationalist« zu sein und trotzdem gleichzeitig das Kreuz von Jesus im Mittelpunkt der biblischen Geschichte und der guten Nachricht zu halten. Schließlich ist es das schuldbefreite und erlöste Volk Gottes, das er zur Schaffung dieser Veränderung einsetzt, und Vergebung und Erlösung kommen nur durch das Kreuz zustande.
Ich kann das Buch sehr empfehlen. Hier eine Leseprobe: Leseprobe_evangelium.pdf.

 Der Pietist Philipp Jacob Spener diagnostizierte im 17. Jh. zwei Bedrohungen für die Gemeinde Jesu: außen Verfolgungen und innen Versuchungen. Er entwarf ein Reformprogramm, welches verschiedene Lebensbereiche erfassen sollte. Einen besonderen Stellenwert räumt er dabei der Theologie und der Theologenausbildung ein. Seine Anmerkungen zur Theologie sind bemerkenswert. Was er damals schrieb, klingt immer noch sehr aktuell:
Der Pietist Philipp Jacob Spener diagnostizierte im 17. Jh. zwei Bedrohungen für die Gemeinde Jesu: außen Verfolgungen und innen Versuchungen. Er entwarf ein Reformprogramm, welches verschiedene Lebensbereiche erfassen sollte. Einen besonderen Stellenwert räumt er dabei der Theologie und der Theologenausbildung ein. Seine Anmerkungen zur Theologie sind bemerkenswert. Was er damals schrieb, klingt immer noch sehr aktuell: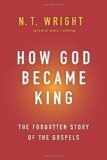 In seinem neusten Buch
In seinem neusten Buch 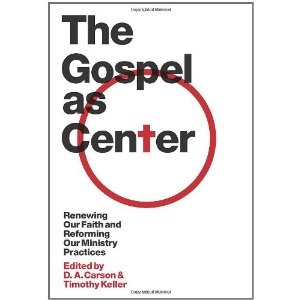 D.A. Carson (Referent auf der
D.A. Carson (Referent auf der 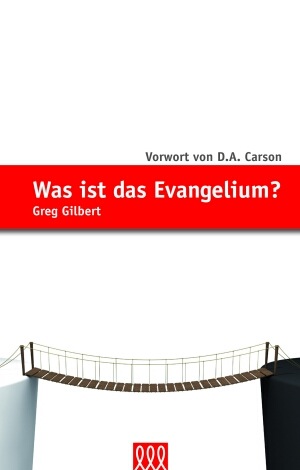 Greg Gilbert setzt sich in seinem Buch Was ist das Evangelium? – der Titel lässt es vermuten –, mit der guten Nachricht von Jesus Christus auseinander. Geschrieben hat er darüber, weil unter Christen oft nicht ganz klar ist, worum es beim Evangelium geht. Einerseits fühlen sich viele überfordert, wenn sie zustimmend sagen sollen, was sie unter »Evangelium« verstehen. Andererseits gibt es heute allerlei Leute, die das Evangelium – meist sendungsbewusst auftretend – neu deuten. Für D.A. Carson ist diese Entwicklung »alarmierend, weil es um ein grundlegend wichtiges Thema geht. Wenn Evangelikale derart unvereinbare Ansichten darüber haben, »was das ›Evangelium‹ eigentlich ist, muss man die Schlussfolgerung ziehen, dass die evangelikale Bewegung ein facettenreiches Phänomen ist, ohne übereinstimmendes Evangelium«, schreibt er in seinem Vorwort.
Greg Gilbert setzt sich in seinem Buch Was ist das Evangelium? – der Titel lässt es vermuten –, mit der guten Nachricht von Jesus Christus auseinander. Geschrieben hat er darüber, weil unter Christen oft nicht ganz klar ist, worum es beim Evangelium geht. Einerseits fühlen sich viele überfordert, wenn sie zustimmend sagen sollen, was sie unter »Evangelium« verstehen. Andererseits gibt es heute allerlei Leute, die das Evangelium – meist sendungsbewusst auftretend – neu deuten. Für D.A. Carson ist diese Entwicklung »alarmierend, weil es um ein grundlegend wichtiges Thema geht. Wenn Evangelikale derart unvereinbare Ansichten darüber haben, »was das ›Evangelium‹ eigentlich ist, muss man die Schlussfolgerung ziehen, dass die evangelikale Bewegung ein facettenreiches Phänomen ist, ohne übereinstimmendes Evangelium«, schreibt er in seinem Vorwort.