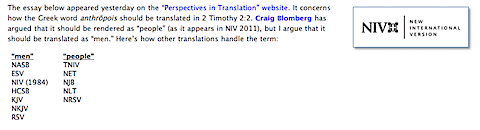Die Schweizer Ausgabe von ideaSpektrum publizierte am 15. Juni (Ausgabe 24/2016, S. 8–11) ein Interview mit Christian Haslebacher zur „Rolle der Frau in der Gemeinde“. Haslebacher arbeitete schon 2004 für das Werk Chrischona in einer Projektgruppe zur Frauenfrage und hat später eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema verfasst und die egalitäre Position verteidigt (erschienen als: „Yes, she can!“, Fontis Verlag: Basel, 2016).
Haslebacher sprach in dem Interview auch über 1. Timotheus 2,12-14. Hier ein Auszug:
idea: Das Ringen geht darum, wie biblische Aussagen heute anzuwenden sind, um der Absicht des Textes gerecht zu werden. Wie verhält sich dies Ihrer Meinung nach bei der Stelle 1. Timotheus 2,12 – ich zitiere: „Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still.“?
Haslebacher: An dieser Schlüsselstelle entscheidet sich die Diskussion. Paulus argumentiert mit der Schöpfungsreihenfolge und dem Fall der Eva. Vertreter der historischen Position nehmen dies als Beweis, dass es sich hier um eine allgemeingültige Anweisung handelt.
idea: Wie nähern Sie sich dieser Stelle?
Haslebacher: Zum einen untersuchte ich, wie der Umgang mit Frauen in der Bibel ganz allgemein beschrieben wird. Wie handelt Gott mit den Frauen? Ich stellte fest, dass dies nicht immer so lief, wie in 1. Timotheus 2,12-14 beschrieben. Dies ist demnach nicht der von Gott generell angewendete Standard. Das ist der erste Punkt. Dann untersuchte ich, wie Paulus auf das Alte Testament verweist. Ich habe insgesamt elf solcher Stellen gründlich studiert.
idea: Was war die wesentliche Erkenntnis?
Haslebacher: Dass Paulus nicht mit der Logik des westlichen Exegeten argumentiert. Er denkt eher wie ein jüdischer Rabbiner, der einen freieren Umgang mit dem Text hat. Diese zwei Punkte führten mich zum Schluss, dass Paulus im 1. Timotheusbrief keine Aussage für alle Gemeinden, in allen Kulturen und zu allen Zeiten macht. Er präsentiert keine umfassende Exegese, sondern wendet die Schrift teilweise selektiv oder ergänzend an, um seine Argumentation zu unterstützen. Er geht nicht wie ein Historiker oder systematischer Theologe vor, sondern er benutzt Analogien zwischen der alttestamentlichen Geschichte und der Gegenwart. Seine Verweise haben einen bildhaften Charakter. Im jüdischen Sinn und Kontext ist das gestattet, während wir uns damit schwertun.
idea: Helge Stadelmann, der ehemalige Rektor der FTH Giessen, sagt: „Die Frage der Frauenordination ist ein Prüfstein der Bibeltreue.“ Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, mit Ihren Aussagen an der Autorität der Heiligen Schrift zu kratzen.
Haslebacher: Es ist möglich, dass dies für manche evangelikale Christen eine Zumutung ist. Für sie riecht das nach Bibelkritik. Aber wie gesagt, ich nehme die Bibel sehr ernst! Meine Begründung erfolgt im Gesamtzeugnis der Schrift. Ich verstehe sie als ein bibelfestes Plädoyer. Eigentlich sind alle NT-Briefe Reaktionen auf Situationen in örtlichen Gemeinden. Die Gemeinde in Ephesus litt unter einer Irrlehre, von der vor allem Frauen betroffen waren. Paulus wollte Ordnung schaffen. Sollte in einer Gemeinde heute eine ähnliche Situation auftreten, sind seine Weisungen für diese Gemeinde genauso gültig. Sie sind aber keine pauschale Ordnung für alle Gemeinden zu allen Zeiten.
Johannes S., fleißiger Kommentator auf dem TheoBlog, hat einen Leserbrief zum Interview und dem zugehörigen Editorial geschrieben, der allerdings nicht veröffentlicht wurde. Mit dem Einverständnis des Autors nachfolgend der Brief im Wortlaut:
Leserbrief
zum Interview „Ich nehme die Bibel sehr ernst“ (Christian Haslebacher) und dem Editorial „Was sagt die Bibel wirklich?“ (Rolf Höneisen)
Das hat Rolf Höneisen richtig erkannt: Christian Haslebacher, der neue Master-Apologet für Leitung und Lehre von Frauen in der Gemeinde ist wahrhaftig kein Feminist und Gender-Ideologe. Denn eine Ehefrau darf nach seiner und der aktuellen Chrischona-Erkenntnis nur leiten und lehren, wenn es ihr Ehemann erlaubt.
Es bedarf keiner prophetischen Begabung für die Einschätzung, dass die Mindesthaltbarkeitsfrist dieser Erkenntnis bald abgelaufen sein dürfte. Haslebacher denkt zwar in Generationen: „Jede Generation liest die Bibel durch die Brille ihrer Zeit.“ Zum Beispiel, wenn es heute um Leitung und Lehre von Frauen in der Gemeinde geht.
„Das hilft“ – wir lesen und staunen –, „gewisse Fehler nicht mehr zu machen …“! „… dafür werden wir wiederum unsere eigenen Fehler machen.“ Dann zitiert er das „Wrightsche Gesetz“, nach dem „20 Prozent seiner Theologie falsch seien – er wisse aber nicht welche. Diese demütige Haltung sollten wir uns alle aneignen …“
Schade, dass Luther nicht so demütig war! Dann hätte er uns die Reformation erspart. Allerdings hätten wir dann ein Event weniger, das gut bezahlte Theologen eine Dekade vorbereitet haben. (Als bescheidener Zeitgenosse wäre ich auch mit einem ökumenischen Kirchentag oder einem GRÜNEN-Parteitag zufrieden gewesen.)
Ich wage also die Prognose, dass wir nicht auf die nächste Generation warten müssen, bis ein Chrischona-Master feststellt, dass Haslebachers Auslegung der Bibelstellen über den Ehemann als Haupt seiner Ehefrau zu den 20 Prozent falscher Chrischona-Theologie im Jahr des Fortschritts 2016 unserer Zeitrechnung gehör(t)en.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass das „Wrightsche Gesetz“ nicht Ausdruck von Demut, sondern von Hochmut ist.
Wenn ich durch die Brille der letzten 200 Jahre Theologiegeschichte die Reformationstheologie betrachte, welche die Bibel noch für historisch zuverlässig hielt, dann erscheinen mir nicht 20 Prozent falsch, sondern 100 Prozent. Ich halte es für Hochmut, wenn Theologen heute meinen, dass ihre Theologie im Rückblick besser abschneiden wird.
Doch zurück in die wunderbare Chrischona-Gegenwart. Haslebacher: „Bei der Frage des Hauptseins komme ich nicht an den zwei bekannten Stellen im Epheser- und im 1. Korintherbrief vorbei.“ Im 1. Brief an Timotheus hat er es dagegen geschafft – bravo –, mit dem Vorwurf der „Scheinlogik“ und des „Zirkelschlusses“. Dabei „wünscht sich Haslebacher ein Ende der gegenseitigen Unterstellungen und ein gemeinsames Ringen um eine sachgemäße Anwendung der biblischen Aussagen.“
Im 1. Korintherbrief argumentiert Paulus ebenso mit der Schöpfungsgeschichte wie im 1. Brief an Timotheus …
Ein Glück, dass in Chrischona keine Ingenieure und Programmierer ausgebildet werden! Mit dem dort gepflegten Denken würden wir in die Steinzeit zurückgeworfen: Jedes Hochhaus und jede Brücke würden bereits beim Bau zusammenstürzen, kein Auto und kein Computer würden funktionieren.
Doch wie pflegte Tante Jolesch zu sagen (Torberg: Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten): Gott bewahre uns vor dem, was noch ein Glück ist.
Und noch ein Glück: Dass Höneisen Haslebacher Ernsthaftigkeit bescheinigt. Ich ziehe bei Non-sens Spaßhaftigkeit vor.
Johannes S.

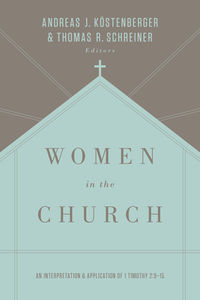
 Kaum ein Thema wird in Gesellschaft und Gemeinde heute kontroverser diskutiert als die Frage nach der Rolle von Mann und Frau. Jacqueline Bee hat ihre bemerkenswerte Arbeit zur Geschlechteridentität 2009 als Buch veröffentlicht.
Kaum ein Thema wird in Gesellschaft und Gemeinde heute kontroverser diskutiert als die Frage nach der Rolle von Mann und Frau. Jacqueline Bee hat ihre bemerkenswerte Arbeit zur Geschlechteridentität 2009 als Buch veröffentlicht.