Gottvertrauen hilft
Laut dem Soziologen Max Weber hat die protestantische Ethik maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Europa wirtschaftich gut entwickeln konnte. Die Christen verstanden ihren Beruf als Gottesdienst, lebten sparsam, lehnten übermäßigen Genuß ab und waren misstrauisch gegenüber zu großem irdischen Reichtum (daher reinvestierten sie).
Felix Noth, stellvertretender Leiter der Abteilung Finanzmärkte am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), stellt in der FAZ die Ergebnisse eine Studie vor, die die stärkende Kraft des Gottvertauens bestätigt.
Untersucht wurde der Einfluss der Kirchenmitgliedschaft auf die wirtschaftliche Erholung nach Naturkatastrophen.
Fazit (FAZ vom 16.06.2025, Nr. 137, S. 16):
Was aber half den Menschen und ihren Unternehmen nach dem Unglück wieder auf? Vor allem: Welchen Einfluss hat die Religion? Die Wirtschaftsforschung nimmt diesen und weitere kulturelle Faktoren seit einigen Jahren vermehrt in den Blick, um ökonomische Entwicklungsprozesse besser zu ergründen, aber auch um zu erforschen, wie kulturelle Aspekte Menschen in Krisen wie etwa der Pandemie stützen. … Die Effekte von unterschiedlichen Facetten von Religion auf den wirtschaftlichen Erholungsprozess sind bemerkenswert, zumal sie sich offenbar gegenseitig verstärken.
Zuerst einmal bietet die Kirche einen Anlaufpunkt. Menschen versammeln sich dort, sie treffen Freunde und Bekannte, bekommen Essen und Informationen. In einer Krise nährt das Zugehörigkeitsgefühl die Hoffnung, dass es weiter-, dass es voran- und wieder aufwärtsgeht. Zumal bei Gläubigen das Vertrauen in die Institutionen oder die Verbundenheit zur Region überdurchschnittlich stark ausgeprägt sind. Es zeigte sich, dass Menschen in Kreisen mit höherer Religionszugehörigkeit öfter als andere in ihrer Heimat geblieben sind, nachdem diese von Katrina und weiteren Stürmen getroffen worden waren. Dort waren somit mehr Köpfe und Hände verfügbar, um den Wiederaufbau zu stemmen. Und zwar ziemlich kluge Köpfe und ziemlich fleißige Hände: Gläubige sind nachweislich besonders wirtschaftsaffin, sie gründen öfter, neigen zu Sparsamkeit und zeigen eine hohe Kooperationsbereitschaft. Bei Protestanten wirken diese Faktoren noch stärker als bei Katholiken.
Gemessen an der Produktivität haben sich in den Jahren 2005 bis 2010 die Betriebsstätten in Kreisen mit höherer Kirchenmitgliedsrate deutlich schneller erholt.
…
Es wäre deshalb kurzsichtig, würde die Menschheit auf die sich mehrenden Flammen und Fluten allein mit technischen Lösungen reagieren. Höhere Deiche, genauere Frühwarnsystem und bessere Hilfen für Betroffene sind zentrale und vorrangige Maßnahmen, wohl aber nur ein Teil der Lösung. Was den Zusammenhalt stärkt, stärkt auch die Krisenfestigkeit der Gesellschaft. Bindekräfte wie Religion beflügeln auch die Wirtschaftsleistung.
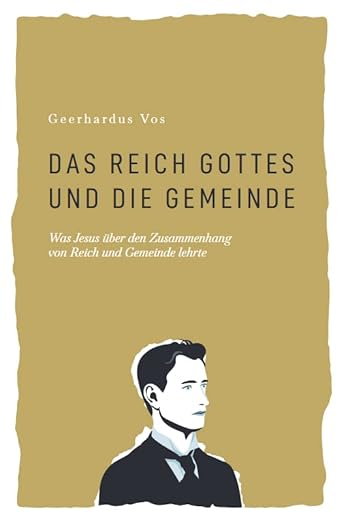 Der in den Niederlanden geborene Geerhardus Vos (1862–1947) war von 1893 bis 1932 Professor für Biblische Theologie am Princeton Theological Seminary (USA). Er ist bekannt geworden für seine Pionierarbeit im Bereich der sogenannten „Biblischen Theologie“, als deren „Vater“ er gelegentlich bezeichnet wird. Er gehört zu jenen Theologen, die an die vollständige Inspiration der Heiligen Schrift glaubten und ihr die höchste Autorität in allen Fragen einräumten und zugleich akademisch auf dem höchsten Niveau arbeiteten. Vos zeigte und begründete in seinen Vorlesungen und Schriften, dass Gottes erlösende Offenbarung als ein sich organisch entfaltender historischer Prozess erfolgt und das diese Einsicht für die Auslegung der Schrift sehr bedeutsam ist.
Der in den Niederlanden geborene Geerhardus Vos (1862–1947) war von 1893 bis 1932 Professor für Biblische Theologie am Princeton Theological Seminary (USA). Er ist bekannt geworden für seine Pionierarbeit im Bereich der sogenannten „Biblischen Theologie“, als deren „Vater“ er gelegentlich bezeichnet wird. Er gehört zu jenen Theologen, die an die vollständige Inspiration der Heiligen Schrift glaubten und ihr die höchste Autorität in allen Fragen einräumten und zugleich akademisch auf dem höchsten Niveau arbeiteten. Vos zeigte und begründete in seinen Vorlesungen und Schriften, dass Gottes erlösende Offenbarung als ein sich organisch entfaltender historischer Prozess erfolgt und das diese Einsicht für die Auslegung der Schrift sehr bedeutsam ist.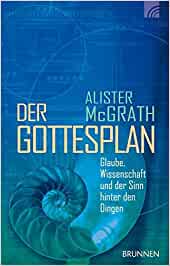 Alister McGrath über die erkenntnistheoretische Bedeutung des Glaubens für C.S. Lewis (Der Gottesplan, Geißen: Brunnen, 2014):
Alister McGrath über die erkenntnistheoretische Bedeutung des Glaubens für C.S. Lewis (Der Gottesplan, Geißen: Brunnen, 2014):