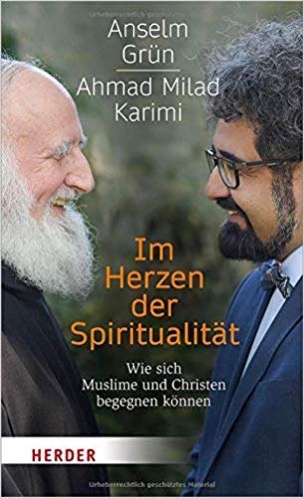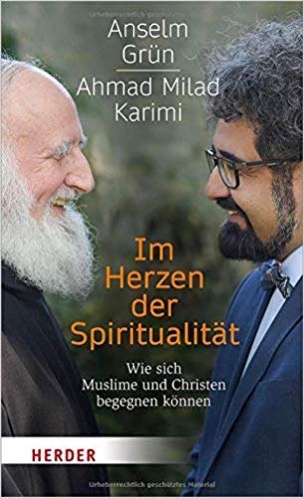 Anselm Grün hat zusammen mit Ahmad Milad Karimi ein Buch geschrieben, um den Dialog zwischen Muslimen und Christen voranzubringen. Wolfgang Schäuble oder Nikolaus Schneider sind begeistert. Im Herzen der Spiritualität wird wieder ein Bestseller. Margot Käßmann wird Anselm-Botschafterin werden.
Anselm Grün hat zusammen mit Ahmad Milad Karimi ein Buch geschrieben, um den Dialog zwischen Muslimen und Christen voranzubringen. Wolfgang Schäuble oder Nikolaus Schneider sind begeistert. Im Herzen der Spiritualität wird wieder ein Bestseller. Margot Käßmann wird Anselm-Botschafterin werden.
Zu den Leuten, die von diesem Buch beeindruckt sind, werden auch viele Evangelikale gehören. In ihren Bücherstuben, Versandhäusern und Regalen wimmelt es von Werken, die der freundliche Mönch verfasst hat. Klarer formuliert: Viele, die sich als Evangelikale verstehen, deuten den christlichen Glauben ähnlich wie Anselm. Mystisch.
Hier einige Zitate von Anselm Grün aus dem neuen Buch. Kommentare kann ich mir bei diesem Geschwurbel sparen.
Die Bibel als Wort Gottes (S. 73)
„Auch wenn wir die Heilige Schrift als Wort Gottes verstehen, das für uns bindend ist, weil es vom Heiligen Geist inspiriert ist, wissen wir doch um die verschiedenen Formen, in denen die Bibel uns das Wort Gottes verkündet. Da gibt es mythologische Erzählungen wie etwa die Erzählung von der Entstehung der Welt und des Menschen. Wir interpretieren diese biblischen Schöpfungsberichte nicht naturwissenschaftlich. Sie beschreiben vielmehr in Bildern den inneren Kern, die Schönheit und das Geheimnis der Schöpfung. Die Bibel kennt geschichtliche Erzählungen, sie kennt Gleichnisse, Berufungsgeschichten, gesetzliche Texte, prophetische Texte, Trostworte und Mahnworte. Es gibt hymnische Texte, Loblieder und Gebete wie etwa die Psalmen. Jede Form hat ihre eigene Wahrheit. Manche Fundamentalisten wollen die Bibel wörtlich auslegen. Aber sie werden damit der eigentlichen Aussageabsicht der Bibel nicht gerecht. Jede Form hat ihre eigene Wahrheit.“
Von Lesen der Bibel (S. 75–76)
„Die Bibel lesen heißt: mit den Worten solange ringen, bis wir sie verstehen. Und wir verstehen sie richtig, wenn wir freundlich mit uns umgehen, wenn wir unser eigener Freund werden. Dann erleben wir auch das Wort Gottes als unseren Freund, der uns zeigt, wie unser Leben gelingt. Wir werden nie damit fertig, die Bibel zu meditieren. Und jede Zeit legt sie immer wieder neu aus. Denn die Worte, die damals geschrieben worden sind, legen unser Leben heute aus und wollen uns Wege aufzeigen, wie unser Leben von Gott her und von Jesus Christus her gelingen kann. Entscheidend ist, dass die Worte der Bibel immer Worte des Lebens sind, Worte, die zu einem authentischen Leben nach dem Geist Jesu führen. Immer wenn uns die Worte Angst machen oder wenn wir die Worte so auslegen, dass wir anderen damit Angst machen, verstehen wir sie nicht im Sinne Jesu, sondern benutzen sie, um unsere eigenen Vorurteile zu verstärken.“
Das Dogma der Uneindeutigkeit (S. 36–37)
„Dogmen sind wahr im Sinn des griechischen Begriff von Wahrheit, aletheia, und das meint, wie Martin Heidegger dieses Wort übersetzt: Unverborgenheit. Dieser Wahrheitsbegriff meint nicht wahre Sätze. Wahrheit bedeutet vielmehr: Der Schleier, der über aller Wirklichkeit liegt, wird gelüftet, und wir erkennen etwas von der tiefsten Wirklichkeit. Wir schauen auf den Grund des Seins. Es wird uns etwas klar, ohne dass wir das in sozusagen mathematisch klare Sätze kleiden könnten. Die Wahrheit ist auch nicht etwas, was ich habe oder besitzen kann. Die Wahrheit kann einem aufgehen. Dogmen sind also keine Festschreibungen, nicht Ausdruck von Rechthaberei, sondern der Versuch, einen Rahmen zu geben, innerhalb dessen die Wahrheit aufleuchtet. Dogmen sind Auslegungen und bedürfen zudem selbst der Auslegung. Für mich ist Dogmatik die Kunst, das Geheimnis offenzuhalten.“
Jesu Gottheit (S. 97):
„Für mich als Theologen ist klar: Dogma heißt nicht, dass ich alles ganz genau erklären kann. Dogma ist für mich vielmehr die Kunst, das Geheimnis offenzuhalten. Auch Dogmen sind letztlich bildhafte Annäherungen an das Geheimnis Gottes und das Geheimnis Jesu. Was die dogmatische Aussage, dass Gott und Mensch in Jesus eins sind, bedeutet, das kann also niemand letztlich ganz verstehen und erschöpfend beschreiben. Unsere Aussagen bleiben offen für das Geheimnis. Ich wehre mich auch gegen Aussagen, die reduzieren. Wenn ich sage: Jesus war nichts als ein religiös besonders begabter Mensch, dann kann ich mich von ihm distanzieren und mich über ihn stellen. Wenn ich aber sage: Jesus ist Gottes Sohn, dann weiß ich zwar auch noch lange nicht, was es wirklich bedeutet. Aber diese Formulierung sagt: Jesus steht mir gegenüber mit einem Anspruch, der dem Anspruch Gottes gleichkommt. Ich erinnere an Paul Tillichs Aussage: „Gott ist das, was uns unbedingt angeht.“ Wenn ich sage, Jesus sei Gottes Sohn, so geht mich dieser Jesus an. Ich nehme seine Worte ernst. Ich ringe mit ihnen. Ich stelle mich nicht über seine Worte. Ich kritisiere Jesus nicht als eine geschichtlich bedingte und beschränkte Persönlichkeit, sondern ich stelle mich seinem göttlichen Anspruch.“
Der Weg der Mystik (S. 222)
„Die Mystiker, die Gott erfahren haben, nageln Gott nicht fest auf starre Dogmen. Sie beschreiben die Erfahrung Gottes in Bildern, die für alle offen sind, die sich auf den Weg zu Gott gemacht haben. Die mystischen Wege aller Religionen verstehen einander, weil sie von ähnlichen Erfahrungen sprechen. Sie deuten diese Erfahrungen nur jeweils auf dem Hintergrund ihrer eigenen theologischen Tradition.“
Sexualethik (S. 207)
„Die Kirche kann die Sexualmoral nicht festschreiben. Sie kann nur im Dialog mit der heutigen Psychologie und Genderforschung theologische Grundsätze aufstellen. Aber gerade in moraltheologischen Fragen gibt es keine festen Dogmen, sondern eine Entwicklung im Dialog mit der jeweiligen Zeit.“
Allerlösung (S. 259)
„Im Tod werden wir Menschen, Christen wie Muslime, Juden, Buddhisten oder Hindus, in die Liebe Gottes hineinsterben. Es ist der eine Gott, der uns alle erwartet. Wenn wir Gott schauen, dann hören unsere Bilder und Vorstellungen, dann hören unsere theologischen Lehren auf. Und wir schauen gemeinsam auf den Gott jenseits aller Bilder, auf den Gott des absoluten Geheimnisses. Aber in diesem Gott werden wir alle eins werden, wenn wir uns von Gott richten, ausrichten lassen auf ihn hin und auf die absolute Liebe hin, in der wir eins werden miteinander und mit Gott. So ist der Blick auf das, was uns erwartet, auch ein Weg, uns schon jetzt miteinander auf Gott hin auszurichten, nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern uns darauf vorzubereiten, dass es im Tod keine Differenzen mehr gibt, sondern wir alle in Gott eins werden.“