Hat die Wissenschaft Gottes Tod bewiesen?
Hier ein kurzes englischsprachiges Video von Eric Metaxas zur Frage, ob die Wissenschaft Gott begraben hat:
Hier ein kurzes englischsprachiges Video von Eric Metaxas zur Frage, ob die Wissenschaft Gott begraben hat:
Ist die Sterbehilfe, die in immer mehr Ländern legalisiert wird, ein Meilenstein im Projekt der Moderne? Die Ärzte Gerrit Hohendorf und Fuat Oduncu und der Philosoph Robert Spaemann argumentieren in ihrem Buch Vom guten Sterben für ein Verbot der abrufbaren Suizidhilfe.
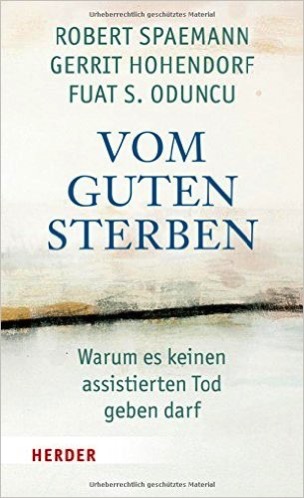 Stephan Sahm schreibt in seiner Rezension:
Stephan Sahm schreibt in seiner Rezension:
Eine Klarstellung der Begriffe stellen die Autoren, die mit der Wirklichkeit in Kliniken vertraut sind, voran. Zudem machen sie den Leser mit den Ergebnissen aktueller Erhebungen zur Praxis der Hilfe beim Suizid in den Ländern bekannt, in denen sie rechtlich und gesellschaftlich akzeptiert ist. Die Zahl der Suizide nimmt dort ausnahmslos zu.
In fünf abschließenden Thesen sprechen sich die Autoren gegen die institutionalisierte Hilfe bei der Selbsttötung aus. Ihre Überlegungen zum Umgang mit Suizidalität in der medizinischen Praxis lohnen die Lektüre auch für diejenigen, die darüber anders denken. Wer sich daranmacht, die Praxis der Medizin nachhaltig zu verändern, sollte wissen, was ansteht.
Wenn etwa Ärzte, wie manche vorschlagen, Patienten in fortgeschrittener Krankheit bei der Selbsttötung sollen helfen dürfen, dann sind sie niemals nur ausführendes Organ des selbstbestimmten Subjekts. Die Umsetzung des Suizidwunsches ist immer, wie die Autoren zu berichten wissen, ein „sozialer Aushandlungsprozess“: Die Ärzte stecken mittendrin, müssen den Suizid gutheißen.
Mehr: www.faz.net.
VD: JS
Wie hier im TheoBlog mehrfach berichtet, hat der amerikanische Religionsphilosoph Prof. Dr. William Lane Craig vor einigen Tagen in München und in Österreich Vorträge zum christlichen Glauben gehalten und mit dem Philosophen Professor Ansgar Beckermann über die Gottesfrage debattiert.
Freundlicherweise hat Johannes B. während der Tour durch Österreich für den TheoBlog einige Fragen stellen können, die William Lane Craig gern beantwortet hat.
TheoBlog: Darf ich mit einer persönlichen Frage anfangen? Haben Sie gute Erinnerungen an Ihre Studienzeit in München?
Prof. Dr. Craig: Ich habe einige gute Erinnerungen und einige schlechte. Meine schlechten Erinnerungen habe ich in meinem Aufsatz „Scheitern“ beschrieben. Obwohl ich diese Erfahrung nicht freiwillig wiederholen wollte, bin ich dennoch froh über dieses Erlebnis des Scheiterns, denn dadurch habe ich Dinge gelernt, die ich in Zeiten des Erfolgs nie gelernt hätte. Davon abgesehen haben meine Frau und ich unter anderem wunderbare Erinnerungen an Tagesausflüge in Süddeutschland zu verschiedenen schönen und interessanten Sehenswürdigkeiten.
TheoBlog: Sind Sie mit dem Ausgang der Craig-Beckermann Debatte am 29. Oktober 2015 in München zufrieden?
Prof. Dr. Craig: Ja, sehr. Ich denke, eine Auswertung der Abschriften der Debatte wird erweisen, dass meine Argumente seinen Kritikpunkten standhalten konnten und er nicht gezeigt hat, dass Gott keine hinreichenden moralischen Gründe gehabt haben könnte, das Böse in der Welt zuzulassen.
TheoBlog: Sie haben in Ihrer Debatte mit A. Beckermann darauf hingewiesen, dass es in Nordamerika ein großes Interesse an der Religionsphilosophie gibt und viele Christen daran beteiligt sind. In Deutschland gibt es diesen Trend bisher nicht. Könnte es an dem immer noch großen Einfluss Immanuel Kants (1724-1804) hierzulande liegen?
Prof. Dr. Craig: Ja, das ist fraglos auch ein Faktor, aber ich vermute, dass soziologische Einflüsse eine weitaus wichtigere Rolle für die gegenwärtige Säkularisierung in Deutschland spielen.
TheoBlog: Sie verteidigen auch den ontologischen Gottesbeweis. Was bringen Sie gegen die Kritik Kants an diesem Beweis vor?
Prof. Dr. Craig: Kant sagte, Existenz sei kein Prädikat. Aber die modernen modallogischen Versionen des ontologischen Gottesbeweises unterstellen in ihren Prämissen gar nicht, dass Existenz ein Prädikat sei, sondern dass Notwendigkeit ein Prädikat ist. Daher sind die modernen modallogischen Versionen des ontologischen Gottesbeweises schlichtweg immun gegen Kants Kritik.
TheoBlog: Welche Voraussetzungen sollte ein junger Christ erfüllen, der in Deutschland an der Uni Philosophie studieren möchte.
Prof. Dr. Craig: Nun, in erster Linie sollte er über eine sehr solide biblische und theologische Grundlage verfügen, denn er wird großen intellektuellen Herausforderungen für seinen Glauben begegnen. Ich denke, er sollte fließend Englisch können, denn dann hat er Zugang zu einer ungeheuren Menge an Ressourcen, die auf Deutsch noch nicht verfügbar sind. Und diese Ressourcen werden ihm eine ganz andere und sehr notwendige Perspektive auf die philosophischen Fragen bieten, die sich während seines Studiums ergeben werden. Ich würde ihm auch raten, die grundlegenden Regeln der Logik so gründlich zu erlernen, bis er sie beherrscht, und eher analytische Philosophie zu studieren, sich also nicht auf kontinentale sondern auf analytische Philosophie zu spezialisieren, die viel klarer, einfacher zu verstehen und gewinnbringender ist.
TheoBlog: Welchen philosophischen Teilgebieten sollte er besonders viel Aufmerksamkeit schenken?
Prof. Dr. Craig: Als Christ sollte er sich vertraut machen mit den Fragestellungen, die in der Religionsphilosophie diskutiert werden. Darüber hinaus sollte er sich von seinen eigenen persönlichen Interessen leiten lassen, auf welchen Bereich der Philosophie er sich spezialisieren möchte. Es ist wichtig, dass er einen Schwerpunkt wählt, der ihn leidenschaftlich interessiert, sei es Metaphysik, Ethik, Philosophie des Geistes, Wissenschaftstheorie oder was auch immer.
TheoBlog: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben!
– – –
Die Fragen stellte Ron Kubsch. Das Interview darf mit Verweis auf die Quelle weiterverbreitet werden.
An dieser Stelle herzlichen Dank an den CVMD für die Einladung von Prof. Craig sowie die großartige Organisation der Veranstaltungen in München sowie die Veröffentlichung des Buches On Guard.
Prof. Ulrich Eibach (Bonn) zeigt in einem kurzen Beitrag, dass der Begriff „Menschenwürde“ zunehmend von seinem Ursprung abgekoppelt wird. Die moderne Lesart der Menschenwürde als empirisch feststellbare Qualität begünstigt die Rechtfertigung der Tötung menschlichen Lebens am seinem Anfang und an seinem Ende. Eibach:
Dieses Verständnis von der Würde des Menschen, das die Väter des GG’es leitete, ist maßgeblich durch die jüdisch-christliche Lehre von der Gottebenbildlichkeit aller Menschen bestimmt. Die Würde, Mensch und zugleich Person zu sein, gründet danach nicht in empirisch feststellbaren Qualitäten, sondern darin, dass Gott den Menschen zu seinem Ebenbild bestimmt hat. Kein Mensch wird dieser Bestimmung im irdischen Leben voll gerecht. Die Gottebenbildlichkeit wird letztlich erst im Reich Gottes, im Sein bei Gott vollendet. Diese letztlich zukünftige Würde ist jedoch dem irdischen Leben von Gott her bereits unverlierbar zugesprochen. Person ist der Mensch allein durch das, was Gott an ihm und für ihn tut. Der Mensch konstituiert weder sein Leben noch seine Würde selbst, sondern er empfängt sie von Gott her. Die MW ist also eine „transzendente Größe“, die von Gott her dem „Lebensträger“ (= Leiblichkeit) zugleich mit dem Gegebensein von Leben, also dem gesamten menschlichen Leben unverlierbar vom Beginn bis zum Tod zugeordnet ist und bleibt, daher nicht in Verlust geraten kann, wie versehrt auch immer Körper, Seele und Geist sein mögen. Es gibt also kein „würdeloses“ und „lebensunwertes“, bloß biologisch menschliches Leben. Im Unterschied zur Person können wir das, wozu der Mensch durch andere Menschen (Erziehung) und sich selbst wird, als Persönlichkeit bezeichnen. Sie ist in der Tat eine empirische Größe, die durch Krankheit abgebaut und zerstört werden kann. Identifiziert man die Person mit der Persönlichkeit, so wird zugleich das Leben mit der Krankheit bzw. der Behinderung gleichgesetzt, der Mensch wird dann durch sie definiert, er ist Behinderter, Pflegefall usw. Man schließt dann zuletzt aus der Zerrüttung der Persönlichkeit, dass es sich um „minderwertiges“, wenn nicht gar „menschenunwürdiges“, „würdeloses“, bloß „vegetatives“ Leben handele, das man um seiner selbst wie auch um der Last willen, die es für andere darstellt, besser von seinem Dasein „erlösen“ solle.
Die idealistische und auch die empiristische Philosophie stellen die Autonomie in den Mittelpunkt ihres Menschenbildes, sie betrachten das Angewiesensein auf andere Menschen als eine minderwertige Form des Menschseins. Nach christlicher Sicht ist Leben immer verdanktes, sich anderen verdankendes Leben. Der Mensch ist, um überhaupt leben zu können – nicht nur im Kindesalter, sondern bleibend das ganze Leben hindurch -, auf Beziehungen zu anderen Menschen angewiesen, nicht nur als Säugling und als behinderter und alter, sondern auch als gesunder und sich „autonom“ wähnender Mensch. Er lebt in und aus diesen Beziehungen und nicht aus sich selber, er verdankt ihnen und damit in erster Linie anderen und nicht sich selbst sein Leben. Daher ist das „Mit-Sein“ (Miteinandersein) Bedingung der Möglichkeit des Selbstseins, hat seinsmäßigen Vorrang vor dem Selbstsein. Diesem Angewiesensein entspricht das Für-Sein der Anderen, ohne das Leben nicht sein, wenigstens aber nicht wirklich gelingen kann. Dies ist auch bei mündigen Menschen der Fall. Es tritt jedoch bei schwer kranken, behinderten und pflegebedürftigen Menschen am deutlichsten hervor, weil bei ihnen das „Aus-sich-selbst-leben-können“ am wenigsten möglich ist.
Mehr bei iDAF: www.i-daf.org.
Der Verlag Hexham Press publiziert in Zusammenarbeit mit dem Acton Institut und der Kuyper Translation Society 12 Bände mit der politische Theologie von Abraham Kuyper in englischer Sprache. Es heißt dazu in einer Mitteilung zum Geburtstag von Kuyper:
 Kuyper’s Collected Works in Public Theology include eight key works spread across 12 volumes:
Kuyper’s Collected Works in Public Theology include eight key works spread across 12 volumes:
Die Bände können elektronisch für die Software Logos oder als gedruckte Bücher erworben werden. Ein Kombi-Angebot gibt es ebenfalls.
Mehr Informationen und ein kurzes Einführungsvideo gibt es hier: blog.logos.com.
Da Abraham Kuyper in Deutschland weniger bekannt ist, hier noch ein zur Werkausgabe passender Auszug aus dem Aufsatz „Abraham Kuyper“, aus: Vergangenheit als Lernfeld, Bonn, 2015, S. 255–266, hier S. 258–262):
[Kuyper] hoffte, die Volkskirche theologisch und strukturell reformieren zu können, stieß jedoch auf so viele Widerstände, dass es schließlich wie schon 1834 zu einer Abspaltung kam. 1886 entstand unter Kuypers Einfluss die neue Gereformeerde Kerken in Nederland, in der unter großen Mühen ungefähr 400.000 „Abgetrennte“ zusammengeführt werden konnten.
Kuyper fragte nicht nur nach dem angemessenen christlichen Einfluss auf die Kultur und die Gestalt der Kirche, sondern schenkte auch den christlichen Schulen große Aufmerksamkeit. Die reformierten Schulen wurden 1806 in öffentliche Einrichtungen umgewandelt. „In ihnen sollte die Erziehung ‚zur Bildung aller christlichen und gesellschaftlichen Tugenden‘ dienen“, wie es das Schulgesetz von 1857 später formulierte. Kuyper nahm an der Verchristlichung staatlicher Schulen Anstoß und plädierte für die Errichtung konfessioneller Schulen. Neben den staatlichen wurden so auch protestantische und katholische Schulen eingerichtet, die freilich erst ab 1920 Fiskalen staatlichen Schulen gleichgestellt wurden.
Durch sein Interesse an der Schulpolitik lernte Kuyper den von ihm sehr geschätzten niederländischen Politiker und Historiker Guillaume Groen van Prinsterer kennen und wurde von ihm in die Politik eingeführt. 1874 erfolgt die Wahl als Abgeordneter in die zweite Kammer des niederländischen Parlaments. Da Geistliche keine Parlamentsmitglieder sein durften, musste er seinen Pastorenberuf aufgeben. Groen und Kuyper machten sich für eine Reformierung der niederländischen Gesellschaft in calvinistischem Sinne stark und bekämpften gegen den als Übel ihrer Zeit angesehenen Geist der Französischen Revolution. Auf diese Weise entstand die „erste wirklich organisierte politische Partei der Niederlande, die ‚Antirevolutionäre‘ oder ‚Christlich-Historische Partei‘, deren Grundsätze Kuyper 1878 mit dem Manifest ‚Ons Program‘ aufstellte und durch ausführliche Erklärungen erläuterte.“ Kuyper wollte die katholischen und liberalen Einflüsse in den Niederlanden keinesfalls leugnen, stellt aber den durch die Reformation erlangten besonderen Charakter im Volke heraus. Er konnte allerdings als Parlamentsmitglied zu seiner großen Enttäuschung nur wenig bewirken. Die Aufgaben im Parlament und große publizistische Aktivitäten wurden ihm bald zu viel. Er erlitt 1876, wie schon 1862, wegen Überarbeitung einen dramatischen Schwächeanfall und musste sich für ein Jahr bei einem Auslandsaufenthalt in der Schweiz, in Italien und in Frankreich regenerieren. Er selbst schrieb, dass er in dieser Zeit der Krise „zur Entschiedenheit der entschiedenen und tiefgreifenden Religion“ seiner Vorfahren geführt wurde. Später, in den Jahren 1901 bis 1905, wurde er allerdings in Personalunion Ministerpräsident und Innenminister der Niederlande und griff so nochmals aktiv in die Politik ein.
Als er nach Holland zurückkehrt, geht er weder in die Politik noch in den Pfarrdienst, sondern widmet sich zwei anderen gewaltigen Herausforderungen: Einerseits der Entwicklung „des Calvinismus sowohl als Theologie wie als Lebensanschauung in einem System, das in den neuen Kontext des 19. Jahrhunderts paßt“, und andererseits der „Ausbildung junger Menschen, die dieses Programm theoretisch auszubauen und in die Praxis umzusetzen gewillt sind.“ Er sah kaum Chancen, diese ambitionierten Pläne an bestehenden Universitäten umzusetzen, da er sich dort hätte mit dem akademischen Establishment arrangieren müssen. Er griff den bereits 1875 geäußerten Gedanken einer Universitätsgründung wieder auf und beabsichtigte die Bildung einer Universität auf der Grundlage einer reformierten Weltanschauung. Kuyper wollte nicht nur das reformierte Bekenntnis gegenüber Liberalismus, Modernismus und Vermittlungstheologie behaupten, sondern offensiv den „christlichen Glauben für alle Fakultäten fruchtbar machen“. 1880 wurde die Freie Universität Amsterdam (holländ. „Vrije Universiteit Amsterdam“, abgekürzt VU) eröffnet. „Frei“ bedeutet in diesem Fall, dass die Hochschule „frei“ von Kirche und Staat arbeitet und ausschließlich von privaten Trägern finanziert wird. Die Hochschule verfolgte das erklärte Ziel, „die reformierten Studenten zur Übernahme verantwortlicher gesellschaftlicher Positionen vorzubereiten“. „Hier kommt das Ideal einer Wissenschaft zum Ausdruck, die ‚souverän im eigenen Bereich‘ bleibt und weder unter der Vormundschaft des Staates noch unter kirchlichem Kuratel sich ihrer eigenen Art entfremdet‘. Im Jahre 1880 hatte sie 5 Studenten, 1885 zählte sie 50 und 1900 126, davon studierten 76 Theologie. Sie hat ihrer Aufgabe jedoch erfüllt, zur Entwicklung einer einheitlichen Geistesart der reformierten Volksschicht beigetragen und die nötigen führenden Köpfe geliefert.“
Kuyper wird Professor an der VU und lehrt vor allem Dogmatik, Enzyklopädie der Theologie, niederländische Sprachwissenschaft, Linguistik und Ästhetik. In dieser Zeit schreibt er seine größten theologischen Bücher. Das einzige wissenschaftliche Werk im engeren Sinn bildet seine drei Bände umfassende Enzyklopädie der Theologie. Schon im Vorwort dieser wissenschaftstheoretischen Schrift machter deutlich, dass er „eine Renaissance des Calvinismus intendiert“. Kuyper möchte den kraftlos gewordenen Calvinismus, der teilweise sektiererische Züge mit starken Absonderungstendenzen aufwies, aus seiner Enge herausführen und für einen lebendigen Dialog mit der Gegenwartskultur zurüsten. Er beabsichtigt also „keine Repristination des ursprünglichen Calvinismus. Vielmehr gelte es, diesen‚ in Berührung [zu] bringen mit dem menschlichen Bewusstsein, wie sich dieses am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt hat‘.“ Zu den anderen bedeutenden Werken gehören seine Pneumatologie (3 Bde.), die Erklärungen zum Heidelberger Katechismus (4 Bde.), eine Ausarbeitung zur Allgemeinen Gnade (3 Bde.) sowie eine Veröffentlichung zu reformierten Liturgie. All diese Publikationen sind Sammlungen von Aufsätzen, die ursprünglich in der Wochenzeitschrift „Der Herold“ erschienen sind.
Es muss erwähnt werden, dass Kuyper zu dieser Zeit einen sehr großen Einfluss auf den ebenfalls bedeutenden Theologen Herman Bavinck ausgeübte und es ihm nach mehreren vergeblichen Anläufen 1902 endlich gelang, Bavinck als Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an die VU zu holen. Bavinck hat viel von Kuyper gelernt und ein durchaus freundschaftliches Verhältnis zu ihm gepflegt. Andererseits konnte der ziemlich eitle Kuyper die Attitüden eines Generals entwickeln und Menschen derb verletzen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Beziehung zwischen Kuyper und dem eher feinsinnigen „Schüler“ später abkühlte und Bavinck vereinzelt auch gegen Kuyper Stellung bezog.
Sie werden kommen, die digitalen Sexsklaven und -sklavinnen. Die Industrie treibt die Pornographiesierung der Gesellschaft mit ihrer Unterstützung auf eine neue qualitative Stufe und sieht in diesem Zweig erhebliche Gewinnchancen. Die Roboter werden nämlich gut zahlende Käufer in die Abhängigkeit führen und sich so zuverlässige Einnahmequellen heranziehen. Freilich werden die Kunden damit auch in eine noch größere Isolation getrieben.
Hoffentlich können warnende Stimmen wie die von Erik Billing und Kathleen Richardson ihren Einfluss wenigstens dämpfen:
Die beiden Robotikexperten wollen zur Diskussion und einer neuen Herangehensweise an das Thema anregen. Weiterhin richten sich die Ethiker explizit an IT-Spezialisten. Diese sollen sich weigern, Programmcodes für Sex-Roboter zu schreiben, Hardware zu entwickeln oder Ideen einzubringen, so die Forderung. Richardson und Billing begründen ihre Aktion zusammengefasst folgendermaßen:
- Kinder und Frauen werden objektiviert.
- Die noch immer vorherrschenden Ängste und Machtstrukturen, welche Frauen und Kinder in einer untergebenen Rolle als Sexobjekte positionieren (Prostitution), werden weiterhin gestärkt und legitimiert.
- Sexroboter wirken der Entwicklung menschlichen Mitgefühls entgegen, welches ausschließlich in einer wechselseitigen Partnerschaft entstehen kann.
- Es wird in Frage gestellt, dass Sexroboter in Frauen- und Kindergestalt weniger einen Nutzen für die Gesellschaft haben als Ungleichheit und Gewalt zu bestärken.
- Die parallele Existenz von Technologie und Sexarbeit zeigt bereits, dass Roboter kein Mittel gegen die Gewalt gegen Prostituierte darstellen und einem Bedarf an menschlichen Körpern entgegenwirken könnte.
Mehr: www.n-tv.de.
Gender Mainstreaming ist Frauenpolitik im neuen Gewand – so lautet die Kritik an der staatlichen Gleichstellungspolitik. Immer mehr Männer wollen das nicht mehr hinnehmen: In Deutschland artikuliert sich eine neue Männerbewegung und verweist auf Defizite in der Theorie und bei der Gesetzgebung.
Susanne Kusicke schreibt für die FAZ:
Schon ein Blick in das Bundesgleichstellungsgesetz nährt diesen Verdacht: „Nach Maßgabe dieses Gesetzes werden Frauen gefördert, um bestehende Benachteiligungen abzubauen“, heißt es in Paragraph eins über die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes. Paragraph 16 regelt die Wahl der Gleichstellungsbeauftragten: „Aus dem Kreis der weiblichen Beschäftigten (werden) eine Gleichstellungsbeauftragte und ihre Stellvertreterin … durch die weiblichen Beschäftigten“ bestellt. Nur Frauen dürfen also für die Gleichstellung sorgen.
Auch ein aktueller Fall weist in diese Richtung: die Besetzung der Kommission, die den neuen Gleichstellungsbericht der Bundesregierung erarbeiten soll: „Acht der zwölf Mitglieder kommen aus dem Bereich Gender Studies oder bezeichnen sich selbst als Feministinnen“, kritisiert der Publizist und Mediator Gerd Riedmeier in einem offenen Brief an die zuständige Bundesministerin Manuela Schwesig (SPD), in deren Amtsbezeichnung zwar Frauen, aber nicht Männer erwähnt werden. Es fehlten Vertreter, die die Bedürfnisse von Jungen, Männern und Vätern in die Diskussion bringen, schreiben die unterzeichnenden sieben Männer-Initiativen. Eine Antwort haben sie nicht bekommen.
Mehr: www.faz.net.
DIE FREIE WELT hat ein hilfreiches Interview mit dem Sexualpädagogen Nikolaus Franke publiziert. Einige Auszüge:
Im momentanen sexualpädagogischen Establishment herrscht eine Kultur der Pluralisierungsethik: Wir nennen alles, was es sonst noch so gibt, hierarchie- und wertungsfrei, halten es Kindern als optionale Modelle vor und erklären Pluralität zum Wert an sich. Alles, was diesem emanzipatorischem Befreiungsgestus der Pluralisierung im Weg steht – und das sind Sexualmoral, Normen, Leitbilder, Naturbegründungen, Normalitätsansprüche, Pathologisierungen –, werden auf diese Weise zu diskursiven Festungen, die es zu schleifen gilt. So kommt es denn auch, dass sich beispielsweise Uwe Sielert berufen fühlt, neben vielem anderen das romantische Liebesideal zu dekonstruieren.
…
Wer annimmt, dass die deutsche Sexualpädagogik besonders von Medizin oder Biologie inspiriert sei, irrt. Seit Jahren gibt es eine Schieflage innerhalb der Sexualpädagogik. Nur so ist zu erklären, dass in den zentralen Thesen der emanzipatorischen Sexualpädagogik proklamiert wird, dass Sexualpädagogik »politisch« zu sein habe – ein unpädagogischer, unwissenschaftlicher Habitus! Es muss uns nicht überraschen, dass Uwe Sielert und seine Spannemänner seit bereits zehn Jahren von einem strategischen Konzept ausgehen, wonach die Schaffung von Gleichberechtigung unter den Geschlechtern langfristig zu einer Pluralisierung der Liebes- und Sexualformen kommen wird.
Die Gendertheorien haben die deutsche Sexualpädagogik zu einer Gesinnungspädagogik verkommen lassen, mittels der die Propheten der Geschlechtsdekonstruktion ihre Fragen in die Sozialisation von Kindern tragen. Hier werden zentrale pädagogische Konzepte verletzt, beispielsweise der Beutelsbacher Konsens, wonach die Welt des Kindes angesprochen werden sollte, nicht die Moral und Weltdeutungen des Pädagogen. Es wäre etwas anderes, wenn diese Maßnahmen im außerschulischen Bereich angeboten werden. In der Schule herrscht ein Indokrinationsverbot. Es ist mir unbegreiflich, weswegen das bisher so ungehindert ablaufen kann.
Mehr: www.freiewelt.net.
VD: AS
An den amerikanischen Universitäten wird die postmoderne politische Korrektheit allmählich zu einer gnadenlosen Ideologie, die die Meinungsfreiheit bedroht. Verantwortlich sind neben einer linken Politik auch die sozialen Medien. Um Fühlen geht es, nicht mehr um Denken oder Wissen. Anstatt etwas Objektives zu lernen, suchen Studierende Aussagen ihrer Professoren, die emotional verletzen könnten. Lehrende und Kommilitonen werden wegen sogenannter „Mikroaggressionen“ sogar denunziert. Hier ein Beispiel:
Lukianoff und Haiti berichten von einem Fall an der Indiana-Perdue University in Indianapolis. Dort hatte ein weißer Student ein Buch über einen Studentenaufstand gegen den Ku Klux Klan 1924 in Notre Dame gelesen; auf dem Einband war ein Foto einer Klan-Versammlung. Dies glaubte ein Kommilitone nicht ertragen zu müssen. Das „Affirmative Action“-Büro der Universität gab dem vorgeblich Beleidigten recht. Das Buch kam auf den Index.
Uwe Schmitt kommt in seinem außergewöhnlich guten Artikel zu dem Schluss:
Es ist schwer zu verstehen, warum die US-Bundesregierung die massive Einschränkung von freier Meinung und Lehre durch dünnhäutige, gefühlige Studenten an Hochschulen nicht nur duldet, sondern fördert. Darauf laufen jedenfalls die seit 2013 gültigen Antidiskriminierungs-Statuten hinaus, die Belästigung und ungleiche Behandlung wegen dem Geschlecht, der Rasse, der Religion oder der Nationalität an Hochschulen unter Strafe stellen.
Sie bringen die Universitäten unter noch größeren Druck und spielt denen in die Hände, die den Campus als realitätsbereinigte Schutzzone für sensible Seelen verstehen.
Wie diese behüteten Eliten, die gewöhnt sind, stets Recht zu haben und zu bekommen, sich in Amerikas rauer Arbeitswelt zurechtfinden sollen, ist offen. Nicht nur Greg Lukianoff und Jonathan Haidt sollte das Sorgen machen. In anderen Ländern der freien Welt, die Amerikas akademischen Trends traditionell folgen, lohnte es sich, in den eigenen Hochschulen nach neuen Sprech- und Denkverboten zu forschen. Es wäre ein Wunder, gäbe es sie nicht.
Hier mehr: www.welt.de.
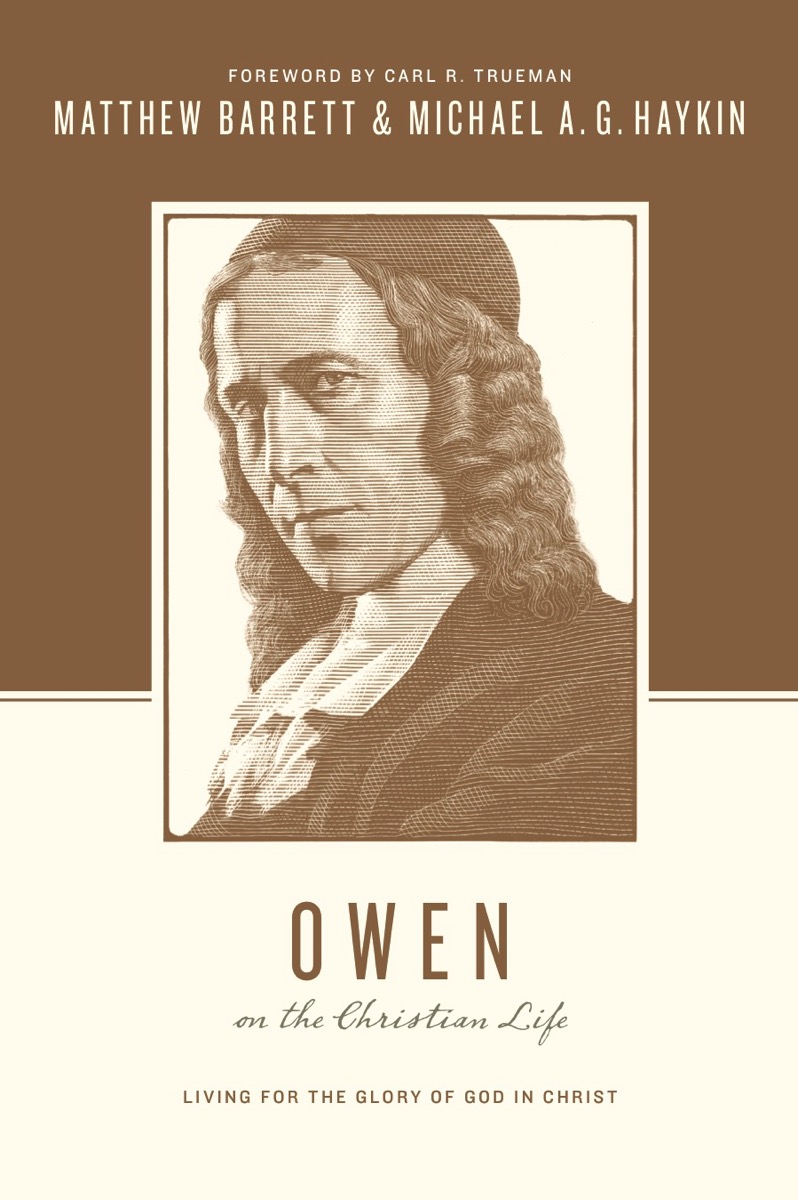 Carl R. Trueman schreibt in seinem Vorwort zur einem neuen Buch über John Owen:
Carl R. Trueman schreibt in seinem Vorwort zur einem neuen Buch über John Owen:
We live in an age when the challenges to Christianity, theological and practical (if one can separate such), are pressing in from all sides. Perhaps the most obvious challenge is the issue of homosexuality. Given the high pastoral stakes in this matter, it is important that we make the right decisions.What has this to do with the thought of a man who died nearly 350 years ago? Simply this: in our era much practical thinking is driven by emotions. Emotions are enemies of fine distinctions. And yet the ethical and practical issues facing the church today demand precisely such fine distinctions if we are to do our task as pastors and church members: comfort the brokenhearted and rebuke those at ease in their sin. And John Owen was of an era when fine distinctions were part of the very fabric of practical theology.
Like one of his great theological heroes, Augustine, Owen was an acute psychologist of the Christian life. Further, as part of the great post-Reformation elaboration and codification of Reformed orthodoxy, he was adept at careful distinctions and precise argument. Finally, as a pastor and preacher, he constantly brought these two things together in practical ways in his congregation. We might add that the pastoral problems in the seventeenth century—greed, sex, anxiety, marital strife, petty personal vendettas — have a remarkably familiar and contemporary feel.
Hier eine Leseprobe zu Owen on the Christian Life: -owen-on-the-christian-life.pdf.