Christus den Weg versperren
 Michael Horton, J. Gresham Machen-Professor für Apologetik und Systematische Theologie am Westminster Theological Seminary (Escondido, Kalifornien), hat einen aufrüttelnden Artikel über das »Christentum ohne Christus« geschrieben, der demnächst in der Zeitschrift Glaube und Denken heute erscheinen wird.
Michael Horton, J. Gresham Machen-Professor für Apologetik und Systematische Theologie am Westminster Theological Seminary (Escondido, Kalifornien), hat einen aufrüttelnden Artikel über das »Christentum ohne Christus« geschrieben, der demnächst in der Zeitschrift Glaube und Denken heute erscheinen wird.
Hier schon Mal ein Auszug:
Wir sind vollkommen abgelenkt rechts, links und in der Mitte. Kinder, die in evangelikalen Kirchen aufwachsen, wissen genauso wenig über die Grundlagen des christlichen Glaubens, wie Jugendliche ohne kirchliche Bindung. Sie bewohnen zunehmend eine kirchliche Welt, die aber immer weniger vom Evangelium durch christozentrische Katechese, Predigt und Sakramente (die Mittel, die Jesus einsetzte für die Jüngerschulung) geformt wird. Die Lieder, die sie singen, sprechen meist das Gefühl an, statt dazu zu dienen, »das Wort Christi reichlich unter ihnen wohnen« zu lassen (Kol 3,16). Und ihre privaten Andachten sind weniger von der Praxis gemeinsamen Gebets und Bibellesens geformt als in vergangenen Generationen. Auf dem Papier muss sich nichts verändern: Sie können noch immer »konservative Evangelikale« sein. Doch das spielt eigentlich keine Rolle mehr, weil die Lehre egal ist. Und das bedeutet, dass der Glaube egal ist. Es funktioniert – das ist alles, was für den Augenblick zählt. Also macht euch an die Arbeit!
So sind nun Menschen dazu aufgerufen, die »gute Nachricht« zu sein und die Mission Christi dadurch erfolgreich zu machen, dass sie »in Beziehungen« und »authentisch« leben. Wo das Neue Testament ein Evangelium verkündigt, das Leben verändert, ist nun unser verändertes Leben das »Evangelium«. »Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus« (2Kor 4,5) ist ausgetauscht worden gegen einen beständigen Appell an unsere persönliche und kollektive Heiligkeit als die Hauptattraktion. Der Guru des Kirchenmarketing George Barna ermutigt uns, auf die Menschen ohne kirchliche Bindung auf der Grundlage unseres Charakters zuzugehen: »Wonach sie suchen, ist ein besseres Leben. Kannst du sie zu einem Ort oder zu einer Gruppe von Menschen führen, die ihnen die Bausteine eines besseren Lebens liefern? Bringe nicht das Christentum als ein System von Regeln ein, sondern als eine Beziehung mit dem Einen, der durch Vorbild führt. Dann suche nach bewährten Wegen, um Bedeutung und Erfolg zu erreichen.« Ich unterstelle ganz und gar nicht, dass wir nicht dem Vorbild Christi folgen sollten oder dass die Kirche nicht Vorbilder und Mentoren haben sollte. Was ich aber nahe lege ist, dass Jüngerschaft bedeutet, andere zu lehren, und zwar sie so gut zu lehren, dass selbst dann, wenn wir als Vorbilder schwanken, die Reife ihrer eigenen Jüngerschaft nicht versagen wird, weil sie in Christus und nicht in uns gegründet ist.
Es ist egal, was wir über unseren Glauben an die Person und das Werk Christi sagen, wenn wir nicht ständig in diesem Glauben baden, dann wird das Endergebnis zu H. Richard Niebuhrs Beschreibung des protestantischen Liberalismus führen: »Ein Gott ohne Zorn brachte Menschen ohne Sünde in ein Reich ohne Gericht durch einen Christus ohne Kreuz.« Laut Christian Smith, Soziologe an der Universität von North Carolina, ist die Religion der Teenager Amerikas, seien sie evangelikal oder liberal, kirchlich gebunden oder nicht, in der Praxis »ein moralistischer, therapeutischer Deismus«. Und die Antwort darauf ist laut vielen Megakirchen und Emerging Churches: »Tue mehr, sei authentischer, lebe transparenter.« Ist das die gute Nachricht, die die Welt ändern wird?
 John Warwick Montgomery schreibt in seinem Buch: Weltgeschichte wohin? (Neuhausen-Stuttgart; Hänssler Verlag, S. 30):
John Warwick Montgomery schreibt in seinem Buch: Weltgeschichte wohin? (Neuhausen-Stuttgart; Hänssler Verlag, S. 30):
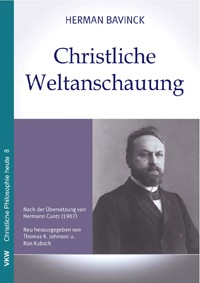 Der Niederländer Herman Bavinck (1854–1921) beschäftigte sich sein ganzes Leben lang mit dem Spannungsfeld von christlichem Glauben und moderner Kultur. Nach einer kurzen Tätigkeit als Pastor einer Gemeinde in Friesland wurde Herman Bavinck 1882 als Professor der Systematischen Theologie an die Theologische Hochschule nach Kampen berufen. 1902 wechselte er nach Amsterdam und lehrte dort als Professor der Theologie an der freien Universität. Heute gilt Bavinck zusammen mit Abraham Kuyper als Hauptvertreter der ersten Generation der neo-calvinistischen Theologie.
Der Niederländer Herman Bavinck (1854–1921) beschäftigte sich sein ganzes Leben lang mit dem Spannungsfeld von christlichem Glauben und moderner Kultur. Nach einer kurzen Tätigkeit als Pastor einer Gemeinde in Friesland wurde Herman Bavinck 1882 als Professor der Systematischen Theologie an die Theologische Hochschule nach Kampen berufen. 1902 wechselte er nach Amsterdam und lehrte dort als Professor der Theologie an der freien Universität. Heute gilt Bavinck zusammen mit Abraham Kuyper als Hauptvertreter der ersten Generation der neo-calvinistischen Theologie. Johannes Calvin schrieb 1536 über eitle geistliche Leiter, die ihre eigenen Gedanken mehr lieben als das Wort Gottes:
Johannes Calvin schrieb 1536 über eitle geistliche Leiter, die ihre eigenen Gedanken mehr lieben als das Wort Gottes: