Nochmal: Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben?
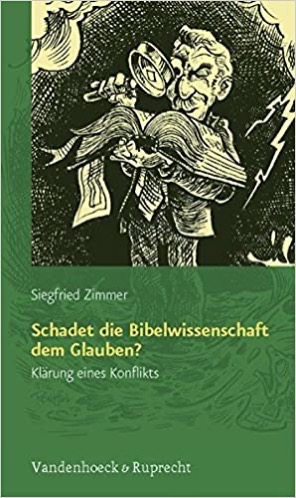 Warum man die Bibel mit gutem Wissen und Gewissen anders lesen kann als Siegfried Zimmer, beschreibe ich in dem Artikel „Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben?“. Darin heißt es:
Warum man die Bibel mit gutem Wissen und Gewissen anders lesen kann als Siegfried Zimmer, beschreibe ich in dem Artikel „Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben?“. Darin heißt es:
In den vergangenen Jahren bin ich mehrfach Leuten begegnet, die ganz begeistert von Worthaus-Konferenzen zurückgekehrt sind. Einige dieser Besucher erklärten mir unverblümt, dass sie die biblizistischen Predigten in ihren Heimatgemeinden leid sind. So wie Peter, dem es schwer viel, überhaupt noch zuzuhören, wenn ein Bruder auf der Kanzel stand und nur das wiederholte, was jeder Leser sowieso im Bibeltext vorfand. „Bei Siegfried Zimmer habe ich endlich mal was Neues gehört“, schwärmte er. „Der nimmt die Bibel auch sehr ernst. Aber er gräbt tiefer und berücksichtigt die Kultur, in der die Texte entstanden sind. Dieser Mann ist nicht nur ein glänzender Rhetoriker, er legt die Schrift wissenschaftlich und relevant aus“, teilte mir Peter mit einem gewissen Stolz mit. Dann wollte er wissen, was ich von Siegfried Zimmer halte.
Siegfried Zimmer bin ich bis heute persönlich nicht begegnet. Worthaus-Vorträge hatte ich freilich schon gehört. So bestätigte ich, dass Zimmer ein wortgewaltiger Redner ist, der seine Hörer in den Bann zieht und manchmal kräftig gegen andere austeilt. Zu seiner Sicht auf die Heilige Schrift konnte ich auch etwas sagen, denn sein Buch Schadet die Bibelwissenschaft dem Glauben? habe ich gelesen. Also fing ich an, zu berichten, was ich dort entdeckt habe. Einiges davon will ich auf den folgenden Seiten erzählen. Ich weiß, dass ich manchem Leser damit viel abverlange.
Der evangelische Pädagoge und Theologe Prof. Dr. Siegfried Zimmer plädiert für ein Bibelverständnis jenseits von radikaler Kritik und Bibelgläubigkeit. Mit geradezu missionarischem Eifer versucht er seit vielen Jahren, evangelikale Christen vom Nutzen der Bibelwissenschaft zu überzeugen. Was soll auch schlecht sein an der Bibelwissenschaft? Sollen wir nicht alle gründlich und nachvollziehbar die Bibel studieren? Würde Zimmer für eine methodisch sorgfältige und nachprüfbare Schriftauslegung werben, würde er bei vielen – mindestens bei mir – offene Türen einrennen. Doch wenn Zimmer von Bibelwissenschaft spricht, meint er eigentlich Bibelkritik, denn beide Begriffe bezeichnen für ihn „das Gleiche“ (S. 147). Das Wort „Bibelkritik“ meidet er im nichtwissenschaftlichen Gespräch aus strategischen Überlegungen. Er möchte nicht unnötig verunsichern. Gemeint ist mit Bibelwissenschaft jedoch ein kritischer Umgang mit der Bibel in „positiver Absicht“. „Der entscheidende Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, heißt: Die Bibel erst einmal aus ihrer Zeit heraus verstehen zu lernen“ (S. 146). Um dieses Ziel zu erreichen, müsse die Bibel traditionskritisch, kirchenkritisch, dogmenkritisch, frömmigkeitskritisch und selbstkritisch gelesen werden (vgl. S. 146). Neuzeitliche Methoden wie die Literarkritik oder die Redaktionskritik sollen helfen, die eigentliche Botschaft der Texte für die Leser von heute verständlich zu machen.
Mehr hier: www.evangelium21.net.
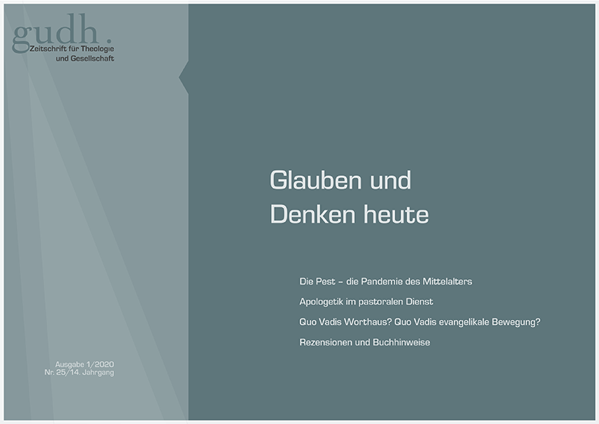 Die Ausgabe Nr. 25 (1/2020) der Zeitschrift für Theologie und Gesellschaft Glauben und Denken heute ist erschienen.
Die Ausgabe Nr. 25 (1/2020) der Zeitschrift für Theologie und Gesellschaft Glauben und Denken heute ist erschienen.