Die abschließenden Teile 4 und 5 der insgesamt informativen Calvin-Serie widerspiegeln vor allem die kritische Calvin-Rezeption, die sich im deutschsprachigen Raum verfestigen konnte. Neuere Forschungen werden m.E. nicht ausreichend berücksichtigt und einseitige Lesarten durch kleine Ungenauigkeiten gestärkt. Die Redakteure haben sich auf das Thema „Calvin als Sittenwächter“ eingeschossen.
Ich möchte kurz zwei Beispiele nennen:
Im Abschnitt zu den Streitigkeiten zwischen Calvin und Castellio um das Jahr 1543 (Teil 4) wird darauf verwiesen, dass Calvin Castellio, der dringend mehr Geld brauchte, eine Predigtstelle verweigerte. Begründet wird dies damit, dass Castellio Calvins Interpretation der Höllenfahrt Christi und des Hohenliedes nicht teilte. Castellio hielt an einer buchstäblichen Auslegung der Höllenfahrt fest und lehnte die damals verbreitete allegorische Auslegung des Hohenliedes ab, nach der das Buch als Beschreibung der Liebe zwischen Christus und der Kirche als Braut zu verstehen sei. So entsteht der Eindruck, Calvin habe Fragen zweit- oder drittrangiger Ordnung dafür instrumentalisiert, seine Interessen rigoros durchzusetzen. Verschwiegen wird hingegen, dass Castellio die Kanonizität des Hohenliedes ablehnte und Calvin diese Frage mit dem großen Thema der Schriftautorität verknüpfte. Calvin wollte vermeiden, dass jemand als Prediger eingesetzt wird, der in der Kanonfrage vom Konsens der Reformatoren abweicht. Bedenkt man, dass Calvin Castellios Tätigkeit als Lehrer nicht infrage stellte, erscheint dieser Zwischenfall in einem anderen Licht. Calvin schrieb in einem Zeugnis, das er im Auftrag seiner Amtsbrüder ausstellte: „Wenn er nicht zugelassen wurde, dann stand dem nicht irgendein dunkler Punkt in seinem Leben oder irgendeine unfromme Lehre in einer wichtigen Glaubensfrage im Wege, sondern einzig der genannte Grund“ (Opp., II, 676, zitiert nach François Wendel, Calvin: Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, Neukirchner Verlag, 1968, S. 64–65).
Verständlicherweise wird der „Fall Servet“ im Teil 5 ausgiebig besprochen („Ein Scheiterhaufen für einen theologischen Gegner“), der zur Verhaftung und schließlich zur Hinrichtung von Michael Servet am 27. Oktober 1553 führte. Servet wurde zum Tode verurteilt, weil er die Dreieinigkeit leugnete. Ein aus heutiger Sicht tragischer Vorfall. Die Redakteure hätten Christoph Strohm allerdings nur weiter zu zitieren brauchen, um zu verdeutlichen, dass die Verurteilung Serverts damals ganz im Rahmen des geltenden Rechts geschah (vgl. ab Minute 7:00). Strohm schreibt (Christoph Strohm, „Calvin und die religiöse Toleranz“, in: M.E. Hirzel u. M. Sallmann (Hg.), 1509 – Johannes Calvin – 2009: Sein Wirken in Kirche und Gesellschaft, Theologischer Verlag Zürich, 2008, S. 222).
Die Rechtslage war eindeutig. Das Reichsrecht sah für die Leugnung der Trinitätslehre die Todesstrafe vor. Nicht nur war im ersten Buch des Codex lustinianus die Bestrafung von Gegnern der orthodoxen Trinitätslehre (vgl. Codex lustinianus 1,1,1) wie auch anderer Häretiker (vgl. Codex lustinianus 1,5) gefordert. Vielmehr sah auch die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. (1500—1558), an die man sich in Genf hielt, eine strenge Bestrafung der Gotteslästerer „an Leib, Leben oder Gliedern“ vor (Artikel 106). Das bisweilen zu lesende Urteil, dass Calvin Servet habe hinrichten lassen, verdeckt diesen Sachverhalt.
Teil 4:
[podcast]http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2012/01/05/dlf_20120105_0940_48d53690.mp3[/podcast]
Teil 5:
[podcast]http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2012/01/06/dlf_20120106_0937_f8d9fbcf.mp3[/podcast]
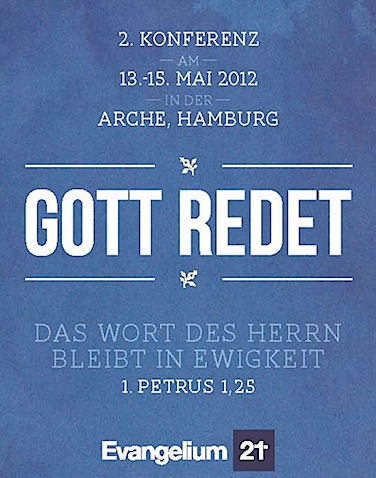 Vom 13.–15, Mai 2012 wird in Hamburg die zweite E21-Konferenz stattfinden. Wir freuen uns auf fesselnde Vorträge, inspirierende Seminare sowie die beiden Hauptreferenten, D.A. Carson und John Piper.
Vom 13.–15, Mai 2012 wird in Hamburg die zweite E21-Konferenz stattfinden. Wir freuen uns auf fesselnde Vorträge, inspirierende Seminare sowie die beiden Hauptreferenten, D.A. Carson und John Piper.