Im dritten Teil der Reihe geht Max Klingberg der Frage nach, ob tatsächlich ein erheblicher Teil der Christenheit wegen ihres Glaubens diskriminiert und zum Teil auch verfolgt wird:
Verfolgung und Diskriminierung von Christen (Teil 3)
Im selben Land zur selben Zeit: Verfolgung und Normalität
Erstaunlicherweise kann die Situation innerhalb eines Landes zur selben Zeit außerordentlich vielgestaltig sein. Das liegt in manchen Fällen an größeren regionalen Unterschieden, wie zum Beispiel zwischen den Verhältnissen in größeren Städten und auf dem Land, an verschiedenen ethnischen Zusammensetzungen, verschiedenen Provinzregierungen oder anderen örtlichen Gegebenheiten. Auch das macht Angaben zur Zahl diskriminierter Christen sehr, sehr schwierig. In Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, leben Christen in den nördlichen Bundesstaaten als stark bis sehr stark benachteiligte Minderheit unter Scharia-Recht. Sehr viele der dortigen Christen wurden zudem eingeschüchtert, bedroht und angegriffen, Tausende wurden in den zehn Jahren getötet.
Doch die Mehrheit der Christen in Nigeria lebt nicht in diesem Umfeld, sondern in überwiegend christlichen geprägten Bundesstaaten oder auch in Gebieten, in denen die Mehrheit der christlichen und muslimischen Einwohner zur selben Ethnie gehört und es bedeutend weniger Spannungen gibt. Alle nigerianischen Christen als verfolgt zu betrachten (und zu zählen) wäre daher grundfalsch. Dasselbe gilt auch für die Volksrepublik China, dessen riesige Einwohnerzahl jede globale Statistik in diese Hinsicht entscheidend beeinflussen.
Während Pastoren nicht registrierter Gemeinden und Rom-treue Priester und Bischöfe sehr wohl damit rechnen müssen, von der chinesischen Staatssicherheit belästigt oder auch verhaftet zu werden, muss das für einen Laien im Riesenheer der chinesischen Wanderarbeiter durchaus nicht gelten.
Wie viele Christen werden also tatsächlich wegen ihres Glaubens diskriminiert?
Eine knifflige Frage. Zu den sehr wenigen aber umso häufiger zitierten „Schätzungen“ fehlen die nötigen Informationen, wie sie zustande gekommen sind. Doch erfreulicherweise gibt es Wissenschaftler, die sich bemühen, transparent und systematisch dieser und ähnlichen Fragen nachzugehen. Besonders empfohlen sei hier das Pew Forum on Religion & Public Life, ein Projekt des Pew Research Center.
Das Pew Research Center versucht über einen veröffentlichten Fragenkatalog Einschränkungen durch Regierungen (Government Restrictions Index, GRI) und Feindseligkeiten innerhalb von Gesellschaften (Social Hostilities Index, SHI) zu erfassen, in welchen Staaten der Erde Religionsfreiheit wie stark eingeschränkt ist. Aus den weiter oben und unten angerissenen Gründen, führen diese Untersuchungen nicht zu einer konkreten Zahl von verfolgten oder diskriminierten Christen. Gleichwohl gibt z.B. der aktuelle Überblicksartikel mit zwei Weltkarten und mehreren anderen Grafiken einen sehr übersichtlichen und guten Einblick in die Problematik.
Die bei Redaktionsschluss aktuellste Ausgabe erschien im September 2012: Rising Tide of Restrictions on Religion.
Was ist Verfolgung? Wie vergleicht man Diskriminierung?
Wer einen Überblick über die Diskriminierung und Verfolgung von Christen sucht, stößt auch abseits von Zahlen sofort auf Schwierigkeiten. Denn: Wo beginnt Diskriminierung, wo Verfolgung? Theoretisch gibt es zumindest auf europäischer Ebene durch den Rat der Europäischen Union eine rechtsverbindliche Definition.
Doch so eindeutig manche Aussagen darin sind, umso unschärfer sind andere. Die Übergänge sind fließend und die Klärung beschäftigt die Gerichte in ungezählten Asylverfahren. Wenn Menschen offensichtlich diskriminiert werden – leiden sie dann wegen ihres Glaubens oder spielen andere Faktoren ebenfalls eine Rolle? Vielleicht sogar eine größere? Vor diesen Fragen steht jeder, der sich näher mit der Diskriminierung von Christen auseinandersetzen möchte.
Das in Washington ansässige und zu Religionsfreiheit arbeitenden Pew Research Center schreibt unter dem Titel „Globale Einschränkungen von Religionen“: „Freiheit – definiert als ‚die Abwesenheit von Behinderung, Beschränkung, Haft oder Repression‘ – ist schwierig, wenn nicht unmöglich, messbar“. In der Praxis zeigt sich, dass jeder Vergleich noch schwieriger ist. Nichtsdestoweniger ist der Versuch, Diskriminierung oder Verfolgung zu „messen“ und zu vergleichen natürlich interessant. Je nach Ansatz sind die Ergebnisse aber durchaus nicht identisch, zumal die Datenlage zu vielen Ländern dünn ist.
Fest steht, dass weltweit ein erheblicher Teil der Christen wegen ihres Glaubens diskriminiert und zum Teil auch stark verfolgt wird. In rund einem Drittel aller Staaten ist die Religion der Bürger starken oder sehr starken Beschränkungen unterworfen. Rund zwei Drittel der Weltbevölkerung lebt in diesen Staaten. Opfer dieser Einschränkungen sind vor allem religiöse Minderheiten.
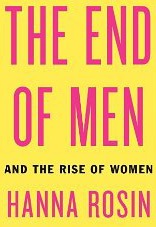 Die US-Autorin Hanna Rosin befeuert mit ihrem neuen Buch
Die US-Autorin Hanna Rosin befeuert mit ihrem neuen Buch 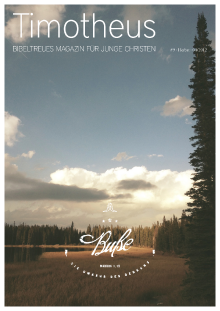 Ausgabe 9 des Magazins Timotheus ist erschienen. Diesmal geht es um ein Thema, über das heute kaum noch gepredigt und gesprochen wird: die Buße.
Ausgabe 9 des Magazins Timotheus ist erschienen. Diesmal geht es um ein Thema, über das heute kaum noch gepredigt und gesprochen wird: die Buße.