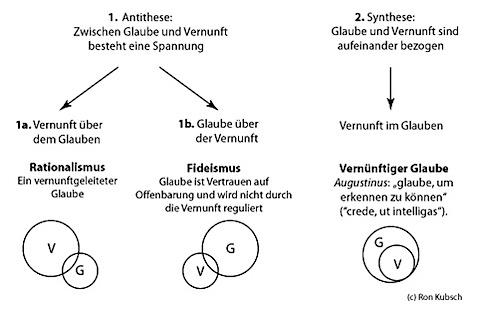Gottesbeweise
 Folgt man dem Alltagsgeschwätz, verbreiteten Lehrbüchern der Philosophie oder der Demagogie des »Neuen Atheismus«, sind seit Immanuel Kant die theoretischen Gottesbeweise erledigt. Kant hatte Gottesbeweise als ehrsüchtige Absichten eingestuft und in den Bereich der über die Grenzen aller Erfahrung hinausgehenden spekulativen Vernunft verwiesen (I. Kant, Kant-W., Bd. 4, S. 693). Niemand, so der akademische Standpunkt mit und nach Kant, würde sich mehr »rühmen können: er wisse, dass ein Gott« sei ( I. Kant, Kant-W, Bd. 4, S. 693.). »Wer die Theologie, sowohl diejenige des christlichen Glaubens als auch diejenige der Philosophie, aus gewachsener Herkunft erfahren hat, zieht es heute vor, im Bereich des Denkens von Gott zu schweigen«, hat uns Martin Heidegger gesagt (zitiert nach Wilhelm Weischedel, Der Gott der Philosophen, Bd. 2, S. 280). Selbst der durchaus »offene« Logiker Franz von Kutschera kommt nach ausführlicher Analyse der bekannten Gottesbeweise zu dem Resümee: »Es gibt zumindest gegenwärtig keinen brauchbaren rationalen Gottesbeweis« (Franz von Kutschera, Vernunft und Glaube, Berlin; New York: de Gruyter, 1991, S. 41).
Folgt man dem Alltagsgeschwätz, verbreiteten Lehrbüchern der Philosophie oder der Demagogie des »Neuen Atheismus«, sind seit Immanuel Kant die theoretischen Gottesbeweise erledigt. Kant hatte Gottesbeweise als ehrsüchtige Absichten eingestuft und in den Bereich der über die Grenzen aller Erfahrung hinausgehenden spekulativen Vernunft verwiesen (I. Kant, Kant-W., Bd. 4, S. 693). Niemand, so der akademische Standpunkt mit und nach Kant, würde sich mehr »rühmen können: er wisse, dass ein Gott« sei ( I. Kant, Kant-W, Bd. 4, S. 693.). »Wer die Theologie, sowohl diejenige des christlichen Glaubens als auch diejenige der Philosophie, aus gewachsener Herkunft erfahren hat, zieht es heute vor, im Bereich des Denkens von Gott zu schweigen«, hat uns Martin Heidegger gesagt (zitiert nach Wilhelm Weischedel, Der Gott der Philosophen, Bd. 2, S. 280). Selbst der durchaus »offene« Logiker Franz von Kutschera kommt nach ausführlicher Analyse der bekannten Gottesbeweise zu dem Resümee: »Es gibt zumindest gegenwärtig keinen brauchbaren rationalen Gottesbeweis« (Franz von Kutschera, Vernunft und Glaube, Berlin; New York: de Gruyter, 1991, S. 41).
Hinter den Kulissen steigt allerdings das Interesse an der Gottesfrage (vgl. auch hier). Zwei Beispiele: Erst kürzlich veranstaltete die Universität Tübingen eine Tagung zum Thema »Gottesbeweise als Herausforderung für die moderne Vernunft« mit sehr honorigen Referenten wie Peter van Inwagen, Armin Kreiner, Richard Swinburne oder Robert Spaemann (hier das Programm). Außerdem ist kürzlich eine umfängliche Darstellung der Gottesbeweise von Joachim Bromand und Guido Kreis beim Suhrkamp Verlag herausgegeben worden. Das Buch:
- Joachim Bromand und Guido Kreis (Hg.): Gottesbeweise von Anselm bis Gödel, Berlin: Suhrkamp Verlag 2011, 20 Euro
versammelt die großen Gottesbeweise des Mittelalters und der Neuzeit ebenso wie die klassischen Einwände von Hume und Kant. Einleitende Essays führen in die Problematik ein und bieten gut verständliche Rekonstruktionen der jeweiligen Argumentationen. Auch die sprachanalytische Debatte wird ausführlich dokumentiert. Dem Mathematiker Kurt Gödel, dessen ontologischer Gottesbeweis bis heute nicht überzeugend widerlegt worden ist (vgl. dazu auch hier), wurde ein ausführliches Kapitel gewidmet (S. 381–487). Sogar der Kalām-Beweis von William L. Craig wird eingehend behandelt (S. 564–598). Im Vorwort schreiben die Bonner Autoren:
Hatte Adorno in der Negativen Dialektik noch generalisierend vermutet, daß »übrigens wohl eine jede [Philosophie] um den ontologischen Gottesbeweis [kreist]«, so scheint sich demgegenüber im nachmetaphysischen Zeitalter jeder ernsthafte Versuch eines Gottesbeweises von selbst zu verbieten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die philosophische Debatte über Gott ist seit einigen Jahren wiedereröffnet und aktueller denn je. Einer der Hauptbeiträge der Philosophie zu dieser Debatte liegt im Projekt der Gottesbeweise. In der sprachanalytischen Metaphysik und Logik werden sie seit Jahrzehnten ausführlich diskutiert. Es ist an der Zeit, die entscheidenden Fragen erneut zu stellen: Was sind eigentlich Gottesbeweise, und wozu sollen sie gut sein?
Obwohl die Verfasser sehr viel wert auf Verständlichkeit legen, ist das Buch keine Profanlektüre, teilweise werden Grundkenntnisse der formalen Logik vorausgesetzt. Aber für Philosophen, Theologen und interessierte Laien ist Gottesbeweise von nun an ein unentbehrliches Nachschlagewerk.
Hier eine Leseprobe mit dem Inhaltsverzeichnis.