Filmemacher Simcha Jacobovici behauptet, die Kreuznägel Jesu aufgespürt zu haben – Experten sind skeptisch. Die SZ schreibt:
Die wundersame Geschichte dieses Fundes beginnt seiner Darstellung zufolge im Jahre 1990: Bei Straßenbauarbeiten in Jerusalem wurde in jener Zeit ein Grab mit Sarkophag entdeckt, dessen Inschriften darauf hindeuteten, dass dies das Familiengrab des Kaiphas sein könnte. Das war jener jüdische Hohepriester Jerusalems, der in den Evangelien als der Mann gezeichnet wird, der maßgeblich für die Verurteilung und Auslieferung des Heilands an die Römer verantwortlich war. In der Grabstätte fanden die Archäologen auch noch Münzen, eine Öllampe, ein Parfümfläschchen – und die fünf Zentimeter langen »römischen Nägel«. Manches davon wanderte ins Museum, nur die Nägel verschwanden.
Vor knapp drei Jahren aber nahm Jacobovici ihre Spur auf – und davon handelt sein neuester Film, der pünktlich zu Ostern fertig geworden ist und über die Feiertage unter anderem auf dem History Channel gezeigt werden soll. Aufgespürt hat er die Nägel schließlich in einem Labor in Tel Aviv, und überdies fand er auch noch eine Erklärung, warum sie als Grabbeigabe ausgerechnet bei Kaiphas gelegen haben sollen. Nach der Kreuzigung nämlich habe der Hohepriester eine Läuterung erlebt und erkannt, dass Jesus tatsächlich der Messias gewesen sei. Seine Nachfahren könnten es also für passend erachtet haben, ihm die hochheiligen Nägel mit auf den Weg in die Ewigkeit zu geben.
…
Was die Nagel-Probe angeht, werden in israelischen Medien bereits Archäologen zitiert, die nicht einmal glauben wollen, dass die Fundstücke aus dem Tel Aviver Labor tatsächlich dem Kaiphas-Grab entstammen – und wenn, dann hätten sie auch ganz profan zum Einritzen der Inschriften verwendet werden können. Auch Jacobovici hat eingeräumt, dass er »nicht 100 Prozent sicher« behaupten könne, dass die präsentierten Nägel vom Kreuz Jesu stammten, schließlich habe kein Zettel daran gehangen, der das bestätigt.
Die Zweifel an der Geschichte sind berechtigt. Die Nachrichtenagentur idea zitiert zwei Experten und einen Journalisten zum Thema:
Nach Ansicht des Archäologen Prof. Gabriel Barkay von der Bar-Ilan-Universität (Ramat Gan bei Tel Aviv) ist weder bewiesen, dass die von Jacobovici gefundenen Nägel tatsächlich aus dem Kaiphas-Grab stammen, noch dass sie bei der Kreuzigung verwendet wurden. Der deutsche Bibel- und Israelexperte Alexander Schick (Westerland/Sylt) wies gegenüber idea darauf hin, dass die Römer zur Zeit Jesu täglich viele Menschen kreuzigen ließen, um den jüdischen Widerstand gegen die Besatzung zu brechen. Deshalb gebe es Tausende Nägel, ohne sie bestimmten Personen zuordnen zu können. In zahlreichen Gräbern habe man Nägel gefunden. Schick hält Jacobovicis Film für »absoluten Blödsinn« und »reine Geschäftemacherei«.
Auch der in Jerusalem wohnende deutsche Journalist Ulrich Sahm sieht die Annahme des Filmemachers kritisch. Der Archäologe Barkay habe Jacobovicis Behauptung widerlegt, dass im Judentum einem Toten nur »Nägel von Gekreuzigten« als Grabbeigabe mitgegeben worden seien, um Seelenheil in der Nachwelt zu bewirken. Laut Barkay hätten Nägel in einem Raum, in dem ein Toter lag, als »unrein« gegolten und seien deshalb nicht in einem Knochenkasten aufbewahrt worden. Man habe Nägel aber verwendet, um die Namen der Verblichenen auf Knochenkästen zu ritzen, und sie dann in der Grabanlage liegen gelassen. Im Internetdienst »Hagalil« schreibt Sahm ferner, dass der Kanadier schon einige fragwürdige Sensationsfilme über Jesus gemacht und sie erfolgreich weltweit vermarktet habe. So habe der Filmemacher die christliche Welt schon einmal mit der »Entdeckung« des Grabes der kompletten Familie Jesu – mitsamt Mutter Maria, Vater Josef, Jesus selber, seiner Ehefrau und einem Sohn – aufgeschreckt. Der Film wurde 2007 an Karfreitag vom privaten Fernsehsender ProSieben ausgestrahlt und von Wissenschaftlern als reine Vermutung kritisiert.
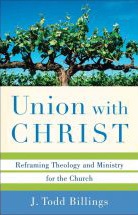 Mein persönliches Buch des Jahres 2011 heißt:
Mein persönliches Buch des Jahres 2011 heißt: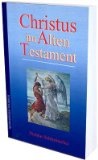 Zum Thema »Christus im Alten Testament« gibt es ein hilfreiches kleines Buch von Thomas Schirrmacher:
Zum Thema »Christus im Alten Testament« gibt es ein hilfreiches kleines Buch von Thomas Schirrmacher: John Warwick Montgomery schreibt in seinem Buch: Weltgeschichte wohin? (Neuhausen-Stuttgart; Hänssler Verlag, S. 30):
John Warwick Montgomery schreibt in seinem Buch: Weltgeschichte wohin? (Neuhausen-Stuttgart; Hänssler Verlag, S. 30):