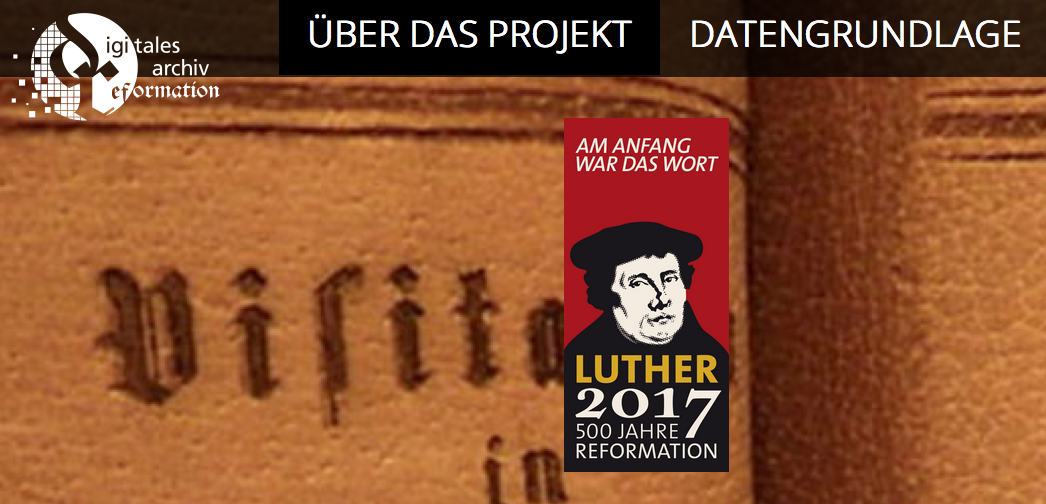Martin Luther vom Feinsten, zu finden in seiner Auslegung zu Römer 14,1 (WA, Bd. 56, S. 502–504):
Im Wesentlichen aber ist der Kern dieses Irrtums die pelagianische Anschauung. Denn wenn es auch jetzt keine Leute gibt, die sich zum Pelagianismus bekennen und danach benennen, so sind doch die meisten in Wirklichkeit und ihrer Anschauung nach Pelagianer, auch ohne dass sie’s wissen, wie z.B. die, die glauben, wenn man nicht dem freien Willen das Vermögen zuerkenne, „das zu tun, was an einem ist“, schon vor der Gnade, dann würde man von Gott zur Sünde gezwungen und müsse notwendigerweise sündigen. Obwohl es der Gipfel der Gottlosigkeit ist, so zu denken, so glauben sie doch ganz sicher und dreist, sie würden, wenn sie nur eine „gute Meinung“ zustande brächten, ganz „unfehlbar“ die Gnade Gottes erlangen, die eingegossen werde. Alsdann gehen sie in größter Sicherheit ihres Weges dahin, dessen gewiss, dass die guten Werke, die sie tun, Gott wohlgefällig seien, und ohne dass sie sich fürderhin auch nur im geringsten ängstigen und darüber beunruhigen, dass man Gottes Gnade anflehen müsse. Denn sie fürchten nicht, dass sie eben damit vielleicht böse handeln könnten, sondern sind gewiss, dass sie recht handeln (Jes 44,20). Warum? Weil sie nicht begreifen, dass Gott die Gottlosen auch in ihren guten Werken sündigen lässt. Damit werden sie freilich nicht zur Sünde gezwungen, sondern sie tun nur, was sie wollen und zwar nach ihrer eigenen „guten Meinung“, wenn sie dies einsehen würden, so wandelten sie in der Furcht, in der Hiob lebte, und sprächen auch mit ihm: „Ich fürchtete alle meine Werke“ (Hiob 9,28); und abermals sagt ein anderer: „Wohl dem, der sich allewege fürchtet“ (Spr 28,14). Darum tun die, die in Wirklichkeit Gutes tun, nichts, ohne dass sie sich nicht immer dabei denken: Wer weiß, ob Gottes Gnade solches mit mir tut? Wer gibt mir die Gewissheit, dass meine „gute Meinung“ wirklich von Gott ist? Wie weiß ich, dass, wenn ich getan habe, was mein ist oder was an mir ist, es Gott wohlgefällt? Die wissen, dass der Mensch aus sich selbst heraus nichts tun kann. Ganz widersinnig und eine starke Stütze für den pelagianischen Irrtum ist daher der bekannte Satz: „Dem, der tut, was an ihm ist, dem gießt Gott unfehlbar die Gnade ein“, wobei man unter dem Ausdruck „tun, was an einem ist“ versteht: irgendetwas tun oder vermögen. Und so kommt’s, dass beinahe die ganze Kirche untergraben ist, nämlich durch das Vertrauen auf diesen Satz. Jeder sündigt mittlerweile unbekümmert darauf los, weil es ja jederzeit in seinem freien Willen steht zu tun, was an ihm ist und so auch die Gnade in seiner Hand liegt. Also gehen sie ohne Furcht ihres Weges dahin, nämlich mit dem Gedanken, sie würden schon zur rechten Zeit tun, was an ihnen ist, und also die Gnade erlangen, über sie sagt Jesaa (44,20): „Auch werden sie nicht sagen: vielleicht ist das Trügerei, was meine rechte Hand treibt“, und Sprüche 14,16: „Ein Weiser fürchtet sich und meidet das Arge. Ein Narr aber fähret hindurch trotziglich“, d. h. er fürchtet nicht, „dass es vielleicht Lüge ist, was seine rechte Hand treibt“. Er zittert nicht, dass sein Gutes vielleicht Böses sein könnte, sondern er ist voller Vertrauen und ist sicher. Warum gebietet dann auch der Apostel Petrus „Fürchtet Gott“? (1.Petr 2,17) und Paulus: „Wir reden den Menschen zu, Gott zu fürchten“ (2.Kor 5,11); und abermals: „Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern“ (Phil 2,12). Und im Ps 2,11 heißt es: „Dienet dem Herrn mit Furcht und freuet euch mit Zittern.“ Wie kann aber einer Gott fürchten oder die eigenen Werke, wenn er sie nicht für arg oder verdächtig hält? Furcht nämlich kommt nur vom Bösen her. Darum schauen die Heiligen in banger Sorge aus nach der Gnade Gottes, die man ohne Unterlass anrufen muss. Sie bauen nicht auf ihre „gute Meinung“ oder auf ihren Eifer insgesamt, sondern sie fürchten noch immer, dass sie Böses tun. Durch solche Furcht gedemütigt trachten sie nach der Gnade und seufzen danach; mit dieser demütigen Bitte aber gewinnen sie sich auch Gottes Huld. Die größte Pest sind heutzutage die Prediger, die von Zeichen vorhandener Gnade predigen, um die Menschen sicher zu machen. Obschon doch gerade dies das deutlichste Zeichen von Gnade ist, wenn man in Furcht und Zittern lebt, und umgekehrt dies das offenkundigste Zeichen göttlichen Zornes, wenn man sicher ist und zuversichtlich auf sich selbst vertraut. Und doch lechzen alle gerade danach mit einer seltsamen Leidenschaft. So findet man nur durch die Furcht die Gnade und nur durch die Gnade wird der Mensch willig zu guten Werken, ohne sie aber ist er unwillig dazu. Durch solche – wenn ich so sagen darf – Unlustigkeit wird er ein Mensch ohne Furcht, hart und sicher, weil er nach außen hin in seinen eigenen Augen und vor den Menschen jene guten Werke vollbringt.