Die Diskussion über Homosexualität beherrscht alle Kanäle. Doch weitaus gravierendere und dringlichere Probleme für Staat und Gesellschaft stehen nicht auf der Tages- und Bildungsordnung. „Die Politik steht in der Pflicht. Wann gehen ihr die Augen auf, wann wird sie wach, wann erkennt sie es?“
Johannes Röser hat für CHRIST IN DER GEGENWART die aktuelle Debatte so gut kommentiert, dass seine Beobachtungen und Forderungen herzlichst empfohlen seien:
Solidarität und Toleranz geht in erster Linie von treuer ehelicher Partnerschaft aus, von einer entsprechenden Erziehung der Söhne und Töchter durch Vater und Mutter, die diese Aufgabe gemeinsam wahrnehmen und ernstnehmen, in guten wie in schlechten Tagen. Die Eltern sind die ersten Lehrer und Vorbilder ihrer Kinder und damit die Ur-Vorbilder für Geisteskultur. Diese Erst-Verantwortung lässt sich nicht delegieren, nicht auf andere Instanzen abwälzen, auch nicht auf die Schule. Aber die Schule soll in subsidiärer Verantwortung die Erziehungsberechtigten und zur Erziehung Verpflichteten – die Eltern – in ihrer großen Aufgabe und Leistung unterstützen. Ehe und Familie gegen die modische Diffusion und Verflachung aufzuwerten, junge Leute in schwierigen Ehezeiten zur Ehe zu ermutigen, gehört zu den vornehmsten Aufgaben des Staatswesens heute. Sein Verfassungsauftrag zum besonderen Schutz von Ehe und Familie ist nicht etwas bloß rückwärtsgewandt verteidigend Statisches, sondern etwas zukunftsorientiert progressiv Dynamisches, zum eigenen Schutz. Die Politik steht in der Pflicht. Wann gehen ihr die Augen auf, wann wird sie wach, wann erkennt sie es?
Stellen wir uns nur einmal vor, im Bildungsplan-Entwurf würde zum Beispiel unter dem Punkt „Berufliche Orientierung“ formuliert: „Zusätzlich zu berücksichtigen unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Ehe und Familie: Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der eigenen Sehnsucht nach stabilen, treuen partnerschaftlichen Beziehungen und den heutigen Schwierigkeiten, diese zu leben, auseinander, mit dem Ziel, in der Berufsfindung auch Fragen der Familiengründung zu bedenken …“ Oder bei „nachhaltiger Entwicklung“: „Schülerinnen und Schüler kennen treue eheliche Beziehungen und reflektieren deren Bedeutung für Staat und Gesellschaft in einer mobilen, globalen Welt.“ Oder bei „Medienbildung“: „Schülerinnen und Schüler nehmen die Dauer-Präsentation kaputter Ehe- und Familienverhältnisse in Fernsehen, Film und sonstigen Medien als Verletzung der Menschenrechte wahr und erkennen, dass der Einsatz für ein gelingendes Ehe- und Familienleben auch in digitalen Medien ein wesentlicher Bestandteil von Zivilcourage in einer pluralen Gesellschaft ist.“ Solche Bildungsplan-Vorschläge sind vermutlich unvorstellbar. Ein Aufschrei kollektiver – medialer – Entrüstung ginge durch das Land. Unvorstellbar? Denken wir nochmal darüber nach.
Hier geht es zum Kommentar: www.christ-in-der-gegenwart.de.
VD: BH
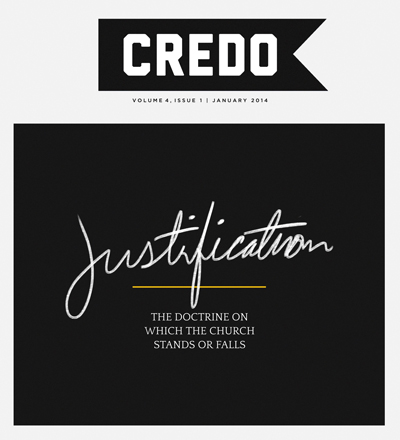 Die neue Ausgabe des CREDO-Magazins (Vol. 4, 1/2014) bringt einige sehr gute Beiträge zum Thema „Rechtfertigung“, unter anderem ein Gespräch mit Michael Horton, Brian Vickers, J.V. Fesko, Guy Waters, Korey Maas, and Philip Ryken.
Die neue Ausgabe des CREDO-Magazins (Vol. 4, 1/2014) bringt einige sehr gute Beiträge zum Thema „Rechtfertigung“, unter anderem ein Gespräch mit Michael Horton, Brian Vickers, J.V. Fesko, Guy Waters, Korey Maas, and Philip Ryken.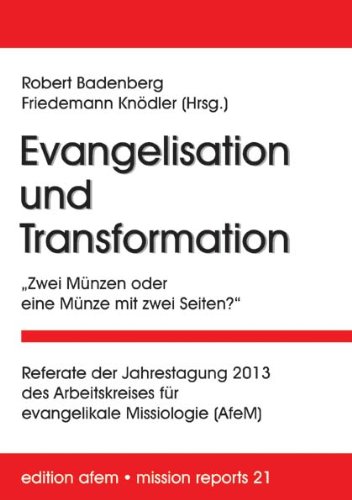 Vom 4. bis 5. Januar 2013 fand in Herrenberg bei Stuttgart eine AfeM-Tagung zur „Transformationstheologie“ statt. Das Buch mit den Referaten und einigen Mitschriften aus den Gesprächsrunden ist inzwischen erschienen als:
Vom 4. bis 5. Januar 2013 fand in Herrenberg bei Stuttgart eine AfeM-Tagung zur „Transformationstheologie“ statt. Das Buch mit den Referaten und einigen Mitschriften aus den Gesprächsrunden ist inzwischen erschienen als: