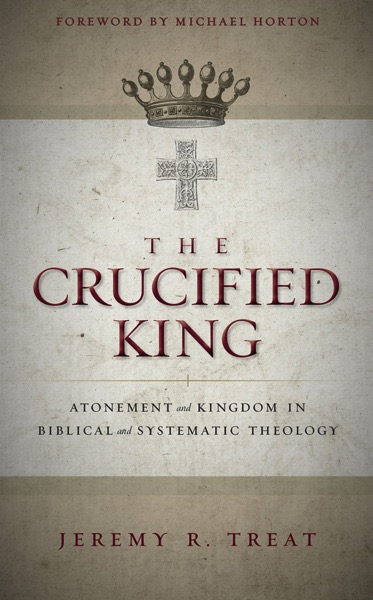Bei N.T. Wright wird das Evangelium anders beschrieben, als wir es in protestantischen Kreisen zu hören gewohnt sind. Wenn er fordert, dass das paulinische Evangelium „wieder ins Zentrum der kirchlichen Verkündigung gestellt“ wird, klingt das zunächst wie ein Ansporn für die mutige Verkündigung der Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, Sünder zu retten. Berücksichtigen wir jedoch, wie Wright das Evangelium erklärt, regen sich erhebliche Sinnverschiebungen.
Er beklagt zunächst, dass das Wort „Evangelium“ in einigen kirchlichen Kreisen (gemeint sind vor allem die evangelikalen) mittlerweile so verwendet werde, als handele es sich um eine Heilsordnung.
„Man hält ‚das Evangelium‘ für eine Beschreibung der Art und Weise, wie Menschen gerettet werden; man meint, bei dem Begriff ginge es um den theologischen Mechanismus, durch den (in der Sprache einiger Leute) Christus unsere Sünde wegnimmt und wir seine Gerechtigkeit annehmen. Andere sagen dazu: ‚Jesus wurde zu meinem persönlichen Retter‘. Wieder andere sagen: ‚Ich bekenne meine Sünde, glaube, dass Jesus für mich starb und vertraue ihm mein Leben an.‘ In vielen kirchlichen Kreisen heißt es, wenn man so etwas oder Ähnliches gehört hat, es wurde ‚das Evangelium‘ gepredigt. Umgekehrt gilt: Wenn man eine Predigt hört, in der der Anspruch Jesu mit den heutigen politischen oder ökologischen Fragen in Verbindung gebracht wird, werden einige sagen, das wäre sicherlich interessant gewesen, aber ‚das Evangelium‘ sei nicht gepredigt worden.“ (N.T. Wright, Worum es Paulus wirklich ging, 2010, S. 48).
Wright findet es nicht schlimm, wenn die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus gepredigt wird. Allerdings würde er diesen Dienst nicht mit dem Evangelium in Verbindung bringen. Wenn Paulus vom Evangelium sprach, dann habe er damit etwas anderes gemeint (vgl. S. 48). Wenn wir uns die Mühe machen und die paulinische Situation erfassen, entdecken wir: „Je jüdischer wir uns das paulinische ‚Evangelium‘ denken, umso stärker konfrontiert es die Anmaßungen des imperialen Kultes, ja aller anderen heidnischen Kulte, seien sie ‚religiös‘ oder säkular‘“ (S. 52). Paulus verkündigt so wie das Alte Testament den Gott, der König wird. „Das paulinische Evangelium war ebenfalls eine Botschaft über den einen wahren Gott, den Gott Israels, und über seinen Sieg über die ganze Welt“ (S. 53). Das Evangelium „selbst ist streng genommen die erzählende Verkündigung, dass Jesus König ist“ (S. 53).
Die Botschaft der Kirche ist folglich die Verkündigung der Königsherrschaft Jesu Christi. Die Kirche sagt der Welt, dass die Zeit der Pseudokönige vorüber ist, weil Jesus als gekreuzigter und auferstandener Messias der wahre König ist. Wright fragt: „Was müssten Prediger des Evangeliums heute tun, damit Menschen über sie dasselbe sagen würden, was sie über Paulus sagten, nämlich dass er angesichts der Ansprüche des Kaisers verkündige, es gäbe ‚einen anderen König, nämlich Jesus‘?“ (S. 194). Seine Antwort:
„Sie müssten – und das ist nur der Anfang – das tun, was Paulus tat, nämlich die Mächte der Welt mit der Nachricht konfrontieren, dass ihre Zeit abgelaufen ist und dass sie Jesus selbst ihre Loyalität schulden. Hier geht es nicht so sehr darum, einzelnen Politikern und einflussreichen Menschen zu sagen, dass sie Jesus als den Herrn ihres eigenen Lebens anerkennen müssen, auch wenn das natürlich ebenfalls wichtig ist. Es geht mehr darum, ihnen im Namen Jesu zu sagen, dass es eine andere Art gibt, Mensch zu sein, einen Weg, der von hingebender Liebe, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und dem Niederreißen traditioneller Grenzziehungen gekennzeichnet ist – den Grenzziehungen, die die Spaltungen verstärken, die Menschen voneinander trennen und oft auch im Streit belassen […] Es geht darum, die ganze Welt unter die Herrschaft Christi zu bringen. Die Botschaft des Evangeliums lässt uns keine Wahl.“ (S. 194–195)
An anderer Stelle sagte er:
„Das Evangelium ist, wie ich betont habe, kein Set von Methoden [!], um Menschen zu Christen zu machen. Es ist auch kein Set von systematischen theologischen Reflexionen, wie wichtig die auch sein mögen. Das Evangelium ist die Verkündigung, dass Jesus der Herr ist – Herr der Welt, Herr des Kosmos, Herr der Erde, der Ozonschicht, Herr der Wale und Wasserfälle, Bäume und Braunbären.“ (S. 193–194).
Mal davon abgesehen, dass wir hier wieder eine Übertreibung haben (Wer hat denn gesagt, dass das Evangelium ein Set von Methoden ist, durch das Menschen andere Menschen zu Christen machen? Sind hier Taufen gemeint?), wird deutlich, dass es um die Verkündigung eines neuen Königs und einer damit im Zusammenhang stehenden neuen Ethik geht. Das Evangelium bietet eine neue Lebensweise an, die sich letztendlich „als Weg der wahren Selbstverwirklichung entpuppen wird“ (S. 198).
Was bedeutet etwa die Verkündigung des Evangeliums im Angesicht der Macht, die unsere Geldinstitute haben? „Wenn Jesus der Herr der Welt ist, dann ist es der große Gott Mammon nicht. Das paulinische Evangelium zu predigen bedeutet, Wege zu finden, die Macht des Mammons in unserer Gesellschaft herauszufordern und diejenigen, die als seine Hohen Priester fungieren, sowie diejenigen, die uns alle drängen, an seinem Schrein anzubeten, daran zu erinnern, dass es einen anderen König gibt, nämlich Jesus“ (S. 195). Auf der globalen Ebene – so Wright – stürzt das Schuldenproblem Millionen Menschen ins Elend, während es eine kleine Minderheit millionenschwer macht. Verkündigung des Evangeliums geschieht dort, wo Kirchen sich zusammenschließen, „um den Götzen Mammon als denjenigen zu kennzeichnen, der er ist, und um an seiner Stelle die Liebe Gottes in Christus anzubeten“ (S. 196).
Ähnliches kann Wright über andere Bereiche sagen. Im Zentrum soll die Verkündigung der Botschaft stehen, dass Jesus Herr ist. Die maßgebliche Aufgabe der Christen sei es, Jesus als Herrn und König zu proklamieren.
Ich gebe zu, dass das Herrsein Jesu oft bei der Verkündigung es Evangeliums unterschlagen wird und manche das Evangelium als so etwas wie eine Eintrittskarte in das Reich Gottes verstehen. Die Herrschaft von Jesus Christus ist ein eindeutiger Bestandteil der Christusbotschaft, so heißt es etwa in Röm 10,9: „Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.“ Die Jünger verkündigten beispielsweise in Antiochia den „Herrn Jesus“ (Apg 11,20). Ich glaube jedoch, dass Wright dem Gesamtzeugnis der Schrift nicht gerecht wird, wenn er Jesus als Erlöser nicht in die Mitte der Evangeliumsverkündigung stellt. Ich will zwei Probleme ansprechen:
Zunächst einmal erscheint das Evangelium als etwas, was wir zu tun haben, also als ein Auftrag oder sogar als eine Art Gesetz. Zwar ist das noch nicht so deutlich, wenn Wright das Evangelium definiert: Jesus als König hat durch seinen Tod das Böse in seinem Kern besiegt. Die Welt muss mit dieser Königsherrschaft konfrontiert werden. Aber es wird sehr deutlich, wenn Wright beschreibt, was es heißt, dieses Evangelium real zu verkündigen: „Es geht mehr darum, ihnen im Namen Jesu zu sagen, dass es eine andere Art gibt, Mensch zu sein, einen Weg, der von hingebender Liebe, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und dem Niederreißen traditioneller Grenzziehungen gekennzeichnet ist …“ (S. 195). Wir setzen uns für die soziale Gerechtigkeit, den Umweltschutz, die Völkerverständigung ein; erinnern Politiker daran, dass Jesus König ist.
Aber ist das Evangelium die Aufforderung, gemäß einer neuen Ethik zu leben? Sicher in dem Sinn, dass jemand, der dem Evangelium glaubt, anderes Leben will, weil nun Jesus sein Herr ist. Doch das Evangelium erscheint im Neuen Testament meist als eine frohe Botschaft (das Gericht klingt gelegentlich an, z. B. in Röm 2,16; Apg 14,6-19), als etwas, was Gott bereits getan hat. Es geht um die Verkündung von Christus als dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der gekommen ist, Sünder zu suchen (vgl. Lk 5,31–32; 1Kor 1,23; 15,3).
Zweitens kann das Herrsein Jesu eine sehr harte Botschaft sein, wenn wir unterschlagen, dass Jesus der Retter ist, der uns aus unserer Sündenverstrickung freigekauft hat. Verkündigen wir Jesus nur als Herrscher, der das Recht hat, zu richten, ist das ohne Angebot der Vergebung eine geradezu schreckliche Nachricht, da alle Menschen vor ihm schuldig sind.
Das Evangelium hat sehr viel mit Jesu stellvertretendem Sterben, seiner Auferstehung und der Vergebung der Sünden zu tun. In Jesus Christus „haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade“ (Eph 1,7). Gott hat uns „errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden“ (Eph 1,13). Was sagte denn Jesus, als er seinen Jüngern den Auftrag gab, dass Evangelium zu verkündigen? Der Evangelist Markus schreibt: „Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden“ (Mk 16,15–16). Paulus schreibt den Christen in Ephesus, dass sie mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, „nachdem sie das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium ihrer Rettung (griech. τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας)“, gehört hatten und ihm glaubten (Eph 1,13). Als Paulus sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedete und in einer ausführlichen Rede Rechenschaft über sein Leben gab, sieht er sich verpflichtet, den Dienst zu tun, den er von seinem Herrn Jesus empfangen hat, nämlich „das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen“ (Apg 20,24). Im ersten Kapitel des 1. Korintherbriefes, in dem es nach N. T. Wright um das Sich-Rühmen aus sozialem Stolz und jüdischer Selbstgefälligkeit geht, spricht Paulus von der Kraft des Evangeliums, die sowohl Juden als auch Griechen, die glauben, zu retten vermag (vgl. 1Kor 1,18–24). Woraus rettet denn das Evangelium? Es erlöst nicht nur vom Stolz und von der Eitelkeit, es rettet aus der Verlorenheit und vor dem drohenden Gericht, denn es wird ein „schlimmes Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben“ (1Petr 4,17, vgl. a. Offb 14).
Es geht also beim Evangelium nicht nur um die Königsherrschaft, sondern es geht um den Erlöser Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wenn wir so wollen, gehören Kreuz und Auferstehung zur Mitte des Evangeliums, wobei meiner Meinung nach der Horizont für die Deutung der Auferstehung das Kreuz ist und nicht umgekehrt. „So sehr für Paulus die Zusammengehörigkeit von Kreuz und Auferstehung zu betonen ist“, schreibt Ulrich Körtner, „muss doch das Gefälle beachtet werden, das zwischen beiden besteht.“ (U. Körtner, „Das Wort vom Kreuz“, in: Klumies u. Du Toit, Paulus – Werk und Wirkung, S. 633.) Verstehenshorizont der Auferstehung ist – wie auch Wolfgang Schrage in seinem Korintherbriefkommentar zeigt –, das Kreuz (W. Schrage, Der erste Brief an die Korinther, Teilbd. 1, 1991, S. 200).

 Gemäß der Neuen Paulusperspektive (NPP) bezeichnet der Ausdruck „Gerechtigkeit Gottes“ (griech. δικαιοσύνη θεοῦ) die Bundestreue Gottes. So legt beispielsweise N.T. Wright sehr viel Wert auf diese Interpretation. In seinem Buch Justification: God’s Plan & Paul’s Vision (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2009, S. 164, hier zitiert nach: N.T. Wright,
Gemäß der Neuen Paulusperspektive (NPP) bezeichnet der Ausdruck „Gerechtigkeit Gottes“ (griech. δικαιοσύνη θεοῦ) die Bundestreue Gottes. So legt beispielsweise N.T. Wright sehr viel Wert auf diese Interpretation. In seinem Buch Justification: God’s Plan & Paul’s Vision (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2009, S. 164, hier zitiert nach: N.T. Wright,