»Zur Kirche gehen« oder »Kirche sein«?
Wenn wir Reich Gottes bauen, indem wir »Evangelium leben«, dann hat es durchaus Sinn, nicht länger zur Kirche zu gehen. Dann könnten wir unser Jüngersein vor Ort leben oder in nachbarschaftlichen Hilfsprojekte investieren. Willard merkt dazu an: »Es ist ein tragischer Fehler, zu denken, Jesus habe uns kurz vor seiner Himmelfahrt sagen wollen, wir sollten – nach modernem Verständnis – Gemeinden gründen … Er wollte vielmehr, dass wir ›Brückenköpfe‹ oder Operationsbasen für das Reich Gottes bauen, wo immer wir auch sind … Die äußerlichen Auswirkungen eines Lebens in Christus bedeuten eine andauernde, moralische Revolution, die solange geht, bis der Plan mit der Menschheit auf Erden vollendet ist.« Die Frage an echte Jünger muss daher lauten: »Werdet ihr eure Kirchen verlassen, um zu seiner Gemeinde zu werden?«
Kimball drückt es ähnlich aus: »Wir können nicht ›zur Kirche gehen‹, wir sind die Kirche.« Von hier aus zieht Kimball die bekannte Grenzlinie zwischen Evangelisation (Mission) und den Kennzeichen der Gemeinde (Gnadenmittel). Kimball hält die Entwicklung seit der Reformation für falsch:
In ihrem Bemühen, der Bibel zu ihrem Recht zu verhelfen und die gesunde Lehre aufzurichten, definierten die Reformatoren die Kennzeichen einer echten Kirche: Sie ist der Ort, an dem das Evangelium verkündet werden soll, die Sakramente richtig ausgeteilt und die Kirchenzucht ausgeübt werden soll. Diese Kennzeichen haben die Definition von Kirche allerdings im Laufe der Zeit immer mehr verengt: Die Kirche ist jetzt ein »Ort« [an dem sich Leute treffen] und keine »Daseinswirklichkeit« mehr. Der Begriff »Kirche« lässt nun an einen »Ort« denken, »an dem ganz bestimmte Dinge ausgeübt werden« wie predigen und Abendmahl halten.
Ironischerweise wird das Verständnis von Kirche als »›Ort, an dem ganz bestimmte Dinge ausgeübt werden‹ wie predigen und Abendmahl halten« von solchen Autoren dem missionarischen Aspekt gegenübergestellt, obgleich Jesus diese Gnadenmittel selbst als Missionsbefehl eingesetzt hat.
Die Verlagerung von der Evangeliumsverkündigung hin zum Gespräch über das Evangelium als weltveränderndem Werkzeug der Gemeinschaft tritt in den Versammlungen klar zutage. Jones spricht über Jacob’s Well, einer wegweisenden Gemeinschaft der Emerging Church in Kansas-City: »Die Gemeinde hat das klassisch-presbyterianische Heiligtum mit den gebeizten Kirchenbänken und der Chorbühne um die erforderlichen Bildschirme ergänzt und die Kanzel durch eine Musikkapelle ersetzt. Die Redner stehen nicht länger auf der Bühne – die gehört nur mehr den Musikern« (meine Hervorhebung). (Man fragt sich, wovon genau sich diese Gemeinde von den Megakirchen unterscheidet?) Bei den Versammlungen der vorwiegend weißen Zuhörerschaft steht auf einer Seite ein Tisch, auf dem sich ein Zitat des derzeitigen anabaptistischen Theologen John Howard Yoder befindet: »Die sichtbare Kirche ist nicht die Überbringerin der christlichen Botschaft, sie selbst ist die Botschaft.«
Auch Jones’ eigene Gemeinde in Minneapolis (Solomon’s Porch, geleitet von Doug Pagitt) geht vom herkömmlichen Gottesdienst zum Gespräch über: »Es geht darum, das Predigtwesen über Bord zu werfen, das den Protestantismus fünfhundert Jahre lang beherrscht hat«, erklärt er. »Die Predigt wird hier dekonstruiert, auf den Kopf gestellt. Die Bibel gilt uns als ,Mitglied der Gemeinschaft‘, mit dem wir im Gespräch stehen; die gemeinschaftliche Auslegung einer Bibelstelle sprudelt nur so aus dem Leben der Gemeinschaft.« Brot, Traubensaft und Wein werden in einer »lauten Partyatmosphäre angeboten; daneben gibt es noch einen stillen Raum zur Meditation.«
[Aber] dieser Teil des Gottesdienstes steht nicht unter irgend jemandes Leitung … Das Abendmahl wird von verschiedenen Leuten eingeleitet – die eine Woche mit einem Gedicht, ein andermal mit einem Zeugniss über »das, was das Herrenmahl mir bedeutet« und die Woche darauf mit den traditionellen »Einsetzungsworten« aus dem allgemeinen Gebetsbuch. [Danach] setzen wir uns, um die Ankündigungen zu hören. Die Kinder kämpfen inzwischen um die letzten Krümel »Abendmahlsbrot«, meistens Zimtkuchen mit Rosinen, Schokoladenkekse oder ein Hartkäsebrot mit Jalapeño.[Es ist ein ziemliches Durcheinander], aber echter Gottesdienst ist eben eine chaotische Sache. Daraus mache ich keinen Hehl. Es soll gar nicht »anständig und ordentlich« zugehen, sondern chaotisch und nur mit einem Anschein von Ordnung, dafür aber mit großer Freude.
Das ist nun freilich alles nicht neu: Der Pietismus ordnete die Kennzeichen der Kirche, wie sie im Missionsbefehl unseres Herrn definiert sind (Predigt, Sakrament und Kirchenzucht) einer ganzen Reihe geistlicher Disziplinen unter, die Jesus nicht angeordnet hatte; einige Erweckungsbewegungen haben dieser Entwicklung noch Vorschub geleistet. Charles Finney, der berühmt-berüchtigte Erweckungsprediger der »Zweiten großen Erweckungsbewegung«, schrieb, der Missionsbefehl laute einfach: »Geht hin … Wir unterliegen hier keinen bestimmten Vorgehensweisen; es wird keine besondere Form verlangt … Der Auftrag [an die Jünger] lautete einfach, das Evangelium auf die effektivste Weise bekannt zu machen … und dadurch Aufmerksamkeit zu erregen und den Gehorsam einer möglichst großen Zahl von Menschen zu sichern. Niemand kann der Bibel irgendwelche Methoden entnehmen.« Das scheint eine doch recht eigenwillige Auslegung zu sein, da der Missionsbefehl die »Methoden« ganz genau angibt – sie finden sich gleich nach der Aufforderung: »Gehet hin!« Nichtsdestoweniger kam es zu jenen praktischen Ergebnissen der anthropozentrischen Theologie Finneys. Derzufolge ist die Kirche nicht Gottes »Botschaft«, der der Dienst am Wort und die Sakramente anvertraut sind, sondern »eine Gesellschaft von Moralreformern«. Wie Finney brauchen die Erwecker keine besondere Ausbildung für ihre Berufung, da es ja mehr die Taten als die Glaubensbekenntnisse sind, die den Auftrag der Kirche in der Welt vorantreiben. Eine ziemlich »chaotisches« Bestreben, in der Tat. Der katholische Historiker Garry Wills schreibt:
Die Versammlung im Feld setzte den Maßstab für die Qualifizierung zum Dienst: Die Prediger wurden durch den Beifall der Menge bestätigt. Institutionelle Qualifikationen, Reinheit der Lehre und persönliche Ausbildung wurden nicht gebraucht – tatsächlich mussten einige gelehrte Diener Unwissenheit vorspielen. Der Diener wurde von den Laien ordiniert, von den Leuten also, die er bekehrt hatte … Der »do-it-yourself«-Glaube verlangte nach einem »do-it-yourself«-Gottesdienst.
Wills zeigt die Verbindung zwischen Botschaft und Methode auf: Statt Evangelium Christi heißt es nun »gute Werke« – das führt logischerweise zur Erniedrigung der Gnadenmittel Gottes zugunsten einer Methodik innerer oder gesellschaftlicher Wandlung.
Fügen wir die Teile zusammen, dann zeigt sich folgendes: Wie das neue Mönchtum das Evangelium ins Gesetz verwandelt und nicht weiter »zur Kirche geht«, sondern »Kirche ist«, so macht sie aus der versammelten Gemeinde eine versprengte Gemeinde. Oder um eine hilfreiche Kategorie Abraham Kuypers zu bemühen: Die Kirche als Institution verschwindet zugunsten »organischer« Gemeinden. Die Christen sind in dieser Welt zu vielerlei aufgerufen: Sie sollen Eltern, Berufstätige, Bürger, Freunde und Nachbarn sein. Wie alle Menschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind, so sind auch die Gläubigen zum Gehorsam gegenüber dem Gebot aufgerufen: Liebe Gott und deinen Nächsten! Die Kirche als Gottes offizielle Botschaft der Gnade jedoch ruft die Menschen von überallher zum Fest. Um eine andere Metapher zu gebrauchen: Die versammelte Gemeinde dient den Einzelnen als »Versalzungsort«; so können wiedergeborene Sünder, die die Vergebung erlangt haben, jede Woche neu als Salz in die Welt »gestreut« werden. Ohne Wort und Sakrament verliert das Salz seine Kraft und ist zu nichts mehr nütze, als dass man es ausschüttet, damit es zertrampelt werde.
 Jeder Bibelschüler oder Theologiestudent muss eine Fülle von wissenschaftlichen Ausarbeitungen verfassen. Dabei soll er unter Beweis stellen, dass er sich in das zu behandelnde Thema eingearbeitet hat und die wichtigsten Techniken wissenschaftlichen Arbeitens beherrscht.
Jeder Bibelschüler oder Theologiestudent muss eine Fülle von wissenschaftlichen Ausarbeitungen verfassen. Dabei soll er unter Beweis stellen, dass er sich in das zu behandelnde Thema eingearbeitet hat und die wichtigsten Techniken wissenschaftlichen Arbeitens beherrscht.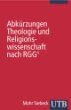 Das ITAG kostet jedoch stolze 129,95 Euro. Bevor sich ein Student das Verzeichnis zulegt, wird er wahrscheinlich lieber »nur« 99,00 Euro ausgeben und dafür das neun Bände umfassende Handwörterbuch Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG4) in vierter Auflage erwerben (siehe dazu hier).
Das ITAG kostet jedoch stolze 129,95 Euro. Bevor sich ein Student das Verzeichnis zulegt, wird er wahrscheinlich lieber »nur« 99,00 Euro ausgeben und dafür das neun Bände umfassende Handwörterbuch Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG4) in vierter Auflage erwerben (siehe dazu hier). Die neue Ausgabe der Zeitschrift Themelios ist erschienen. Neben zahlreichen Rezensionen enthält Themelios 36.1 folgende Beiträge:
Die neue Ausgabe der Zeitschrift Themelios ist erschienen. Neben zahlreichen Rezensionen enthält Themelios 36.1 folgende Beiträge: Der vollständige Artikel von Jochen Teuffel kann
Der vollständige Artikel von Jochen Teuffel kann  Am 10. Dezember ist der aus der Schweiz stammende Theologe
Am 10. Dezember ist der aus der Schweiz stammende Theologe  Die Ausgabe 35.3 des theologischen Journals Themelios ist online abrufbar.
Die Ausgabe 35.3 des theologischen Journals Themelios ist online abrufbar.